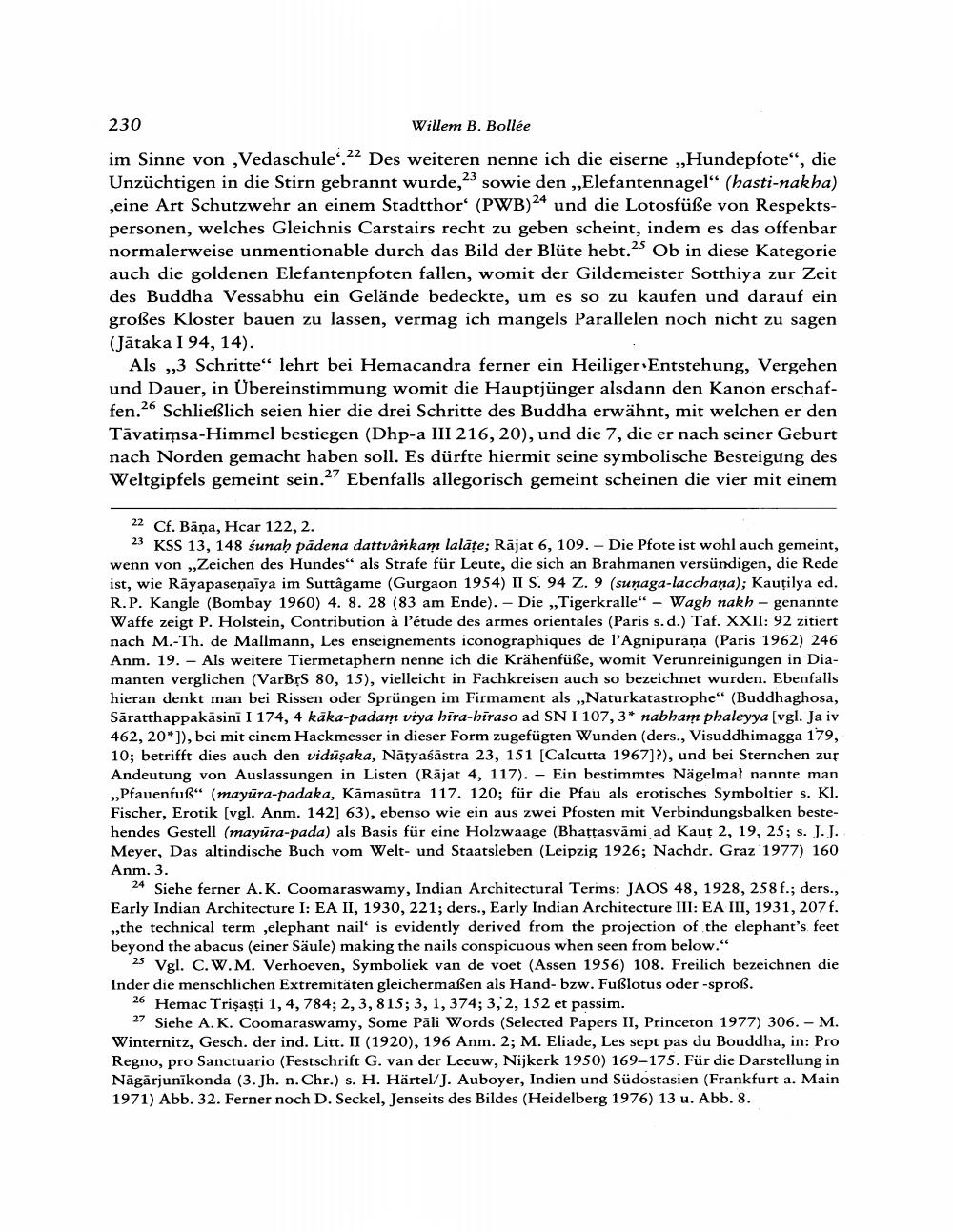Book Title: Traditionell Indische Vorstellungen Uber Die Fuse In Literatur und Kunst Author(s): Fur Klaus Fischer Publisher: Fur Klaus Fischer View full book textPage 4
________________ 230 Willem B. Bollée im Sinne von Vedaschule .22 Des weiteren nenne ich die eiserne „Hundepfote“, die Unzüchtigen in die Stirn gebrannt wurde,23 sowie den ,,Elefantennagel" (hasti-nakha) „eine Art Schutzwehr an einem Stadtthor' (PWB)24 und die Lotosfüße von Respektspersonen, welches Gleichnis Carstairs recht zu geben scheint, indem es das offenbar normalerweise unmentionable durch das Bild der Blüte hebt.29 Ob in diese Kategorie auch die goldenen Elefantenpfoten fallen, womit der Gildemeister Sotthiya zur Zeit des Buddha Vessabhu ein Gelände bedeckte, um es so zu kaufen und darauf ein großes Kloster bauen zu lassen, vermag ich mangels Parallelen noch nicht zu sagen (Jātaka I 94, 14). Als ,,3 Schritte" lehrt bei Hemacandra ferner ein Heiliger Entstehung, Vergehen und Dauer, in Übereinstimmung womit die Hauptjünger alsdann den Kanon erschaffen.26 Schließlich seien hier die drei Schritte des Buddha erwähnt, mit welchen er den Tāvatimsa-Himmel bestiegen (Dhp-a III 216, 20), und die 7, die er nach seiner Geburt nach Norden gemacht haben soll. Es dürfte hiermit seine symbolische Besteigung des Weltgipfels gemeint sein.Ebenfalls allegorisch gemeint scheinen die vier mit einem 22 Cf. Bāņa, Hear 122, 2. 23 KSS 13, 148 sunah padena dattvärkam lalāte; Rājat 6, 109. - Die Pfote ist wohl auch gemeint, wenn von „Zeichen des Hundes" als Strafe für Leute, die sich an Brahmanen versündigen, die Rede ist, wie Rāyapaseņaiya im Suttâgame (Gurgaon 1954) II S. 94 Z. 9 (sunaga-lacchana); Kautilya ed. R.P. Kangle (Bombay 1960) 4. 8. 28 (83 am Ende). - Die „Tigerkralle" - Wagh nakh - genannte Waffe zeigt P. Holstein, Contribution à l'étude des armes orientales (Paris s.d.) Taf. XXII: 92 zitiert nach M.-Th. de Mallmann, Les enseignements iconographiques de l'Agnipurāņa (Paris 1962) 246 Anm. 19. - Als weitere Tiermetaphern nenne ich die Krähenfüße, womit Verunreinigungen in Diamanten verglichen (VarBỊS 80, 15), vielleicht in Fachkreisen auch so bezeichnet wurden. Ebenfalls hieran denkt man bei Rissen oder Sprüngen im Firmament als „Naturkatastrophe" (Buddhaghosa, Sāratthappakāsini I 174, 4 kāka-padam viya hira-hiraso ad SNI 107,3* nabham phaleyya (vgl. Ja iv 462, 20*]), bei mit einem Hackmesser in dieser Form zugefügten Wunden (ders., Visuddhimagga 179, 10; betrifft dies auch den viduşaka, Nātyaśāstra 23, 151 (Calcutta 1967]?), und bei Sternchen zur Andeutung von Auslassungen in Listen (Rājat 4, 117). - Ein bestimmtes Nägelmal nannte man „Pfauenfuß“ (mayūra-padaka, Kāmasūtra 117. 120; für die Pfau als erotisches Symboltier s. Kl. Fischer, Erotik (vgl. Anm. 142] 63), ebenso wie ein aus zwei Pfosten mit Verbindungsbalken bestehendes Gestell (mayura-pada) als Basis für eine Holzwaage (Bhattasvāmi ad Kaut 2, 19, 25; s. J.J. Meyer, Das altindische Buch vom Welt- und Staatsleben (Leipzig 1926; Nachdr. Graz 1977) 160 Anm. 3. 24 Siehe ferner A.K. Coomaraswamy, Indian Architectural Terms: JAOS 48, 1928, 258 f.; ders., Early Indian Architecture I: EA II, 1930, 221; ders., Early Indian Architecture III: EA III, 1931, 207f. „the technical term ,elephant nail' is evidently derived from the projection of the elephant's feet beyond the abacus (einer Säule) making the nails conspicuous when seen from below." 25 Vgl. C. W.M. Verhoeven, Symboliek van de voet (Assen 1956) 108. Freilich bezeichnen die Inder die menschlichen Extremitäten gleichermaßen als Hand- bzw. Fußlotus oder -sproß. 26 Hemac Trişasti 1, 4,784; 2, 3, 815; 3, 1, 374; 3, 2, 152 et passim. 27 Siehe A.K. Coomaraswamy, Some Pāli Words (Selected Papers II, Princeton 1977) 306. - M. Winternitz, Gesch. der ind. Litt. II (1920), 196 Anm. 2; M. Eliade, Les sept pas du Bouddha, in: Pro Regno, pro Sanctuario (Festschrift G. van der Leeuw, Nijkerk 1950) 169-175. Für die Darstellung in Nāgārjunīkonda (3. Jh. n. Chr.) s. H. Härtel/J. Auboyer, Indien und Südostasien (Frankfurt a. Main 1971) Abb. 32. Ferner noch D. Seckel, Jenseits des Bildes (Heidelberg 1976) 13 u. Abb. 8.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 55