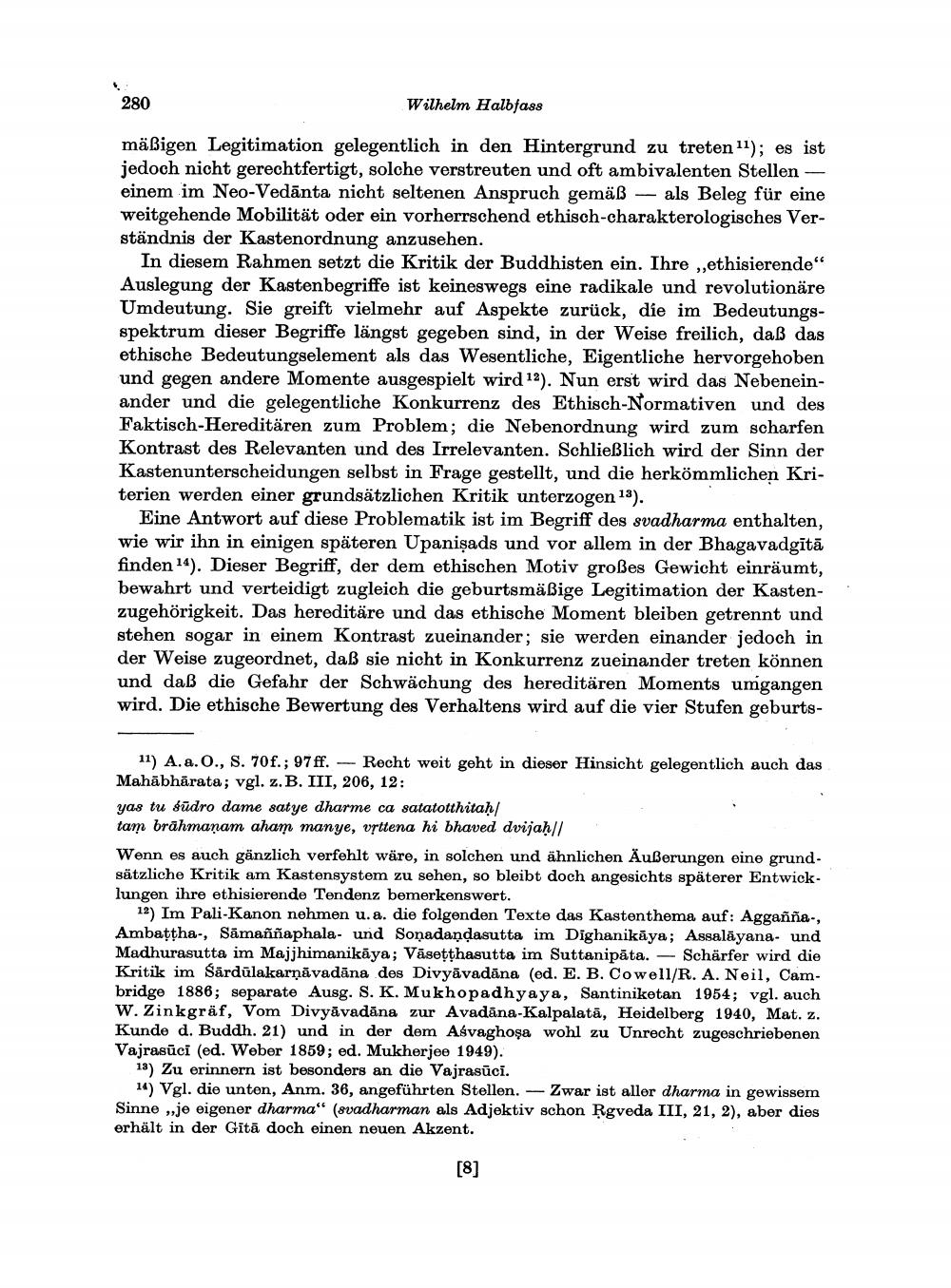Book Title: Zur Theorie Der Kastenordnung In Der Indischen Philosophie Author(s): Wilhelm Halbfass Publisher: Wilhelm Halbfass View full book textPage 4
________________ 280 Wilhelm Halbfass mäßigen Legitimation gelegentlich in den Hintergrund zu treten 11); es ist jedoch nicht gerechtfertigt, solche verstreuten und oft ambivalenten Stelleneinem im Neo-Vedānta nicht seltenen Anspruch gemäß --- als Beleg für eine weitgehende Mobilität oder ein vorherrschend ethisch-charakterologisches Verständnis der Kastenordnung anzusehen. In diesem Rahmen setzt die Kritik der Buddhisten ein. Ihre ,,ethisierende" Auslegung der Kastenbegriffe ist keineswegs eine radikale und revolutionäre Umdeutung. Sie greift vielmehr auf Aspekte zurück, die im Bedeutungsspektrum dieser Begriffe längst gegeben sind, in der Weise freilich, daß das ethische Bedeutungselement als das Wesentliche, Eigentliche hervorgehoben und gegen andere Momente ausgespielt wird 12). Nun erst wird das Nebeneinander und die gelegentliche Konkurrenz des Ethisch-Normativen und des Faktisch-Hereditären zum Problem; die Nebenordnung wird zum scharfen Kontrast des Relevanten und des Irrelevanten. Schließlich wird der Sinn der Kastenunterscheidungen selbst in Frage gestellt, und die herkömmlichen Kriterien werden einer grundsätzlichen Kritik unterzogen 13). Eine Antwort auf diese Problematik ist im Begriff des svadharma enthalten, wie wir ihn in einigen späteren Upanişads und vor allem in der Bhagavadgītā finden 14). Dieser Begriff, der dem ethischen Motiv großes Gewicht einräumt, bewahrt und verteidigt zugleich die geburtsmäßige Legitimation der Kastenzugehörigkeit. Das hereditäre und das ethische Moment bleiben getrennt und stehen sogar in einem Kontrast zueinander; sie werden einander jedoch in der Weise zugeordnet, daß sie nicht in Konkurrenz zueinander treten können und daß die Gefahr der Schwächung des hereditären Moments umgangen wird. Die ethische Bewertung des Verhaltens wird auf die vier Stufen geburts 11) A. a.O., S. 70f.; 97 ff. --- Recht weit geht in dieser Hinsicht gelegentlich auch das Mahābhārata; vgl. z. B. III, 206, 12: yas tu dūdro dame satye dharme ca satatotthitaḥ tam brāhmaṇam aham manye, vrttena hi bhaved dvijaḥ|| Wenn es auch gänzlich verfehlt wäre, in solchen und ähnlichen Äußerungen eine grund. sätzliche Kritik am Kastensystem zu sehen, so bleibt doch angesichts späterer Entwicklungen ihre ethisierende Tendenz bemerkenswert. 12) Im Pali-Kanon nehmen u. a. die folgenden Texte das Kastenthema auf: Aggañña-, Ambattha-, Sämaññaphala- und Sonadandasutta im Dighanikāya; Assalāyana. und Madhurasutta im Majjhimanikāya; Vāsetthasutta im Suttanipäta. - Schärfer wird die Kritik im Särdülakarnăvadāna des Divyāvadāna (ed. E. B. Cowell/R. A. Neil, Cambridge 1886; separate Ausg. S. K. Mukhopadhyaya, Santiniketan 1954; vgl. auch W. Zinkgräf, Vom Divyāvadāna zur Avadana-Kalpalatā, Heidelberg 1940, Mat. z. Kunde d. Buddh. 21) und in der dem Asvaghoşa wohl zu Unrecht zugeschriebenen Vajrasuci (ed. Weber 1859; ed. Mukherjee 1949). 18) Zu erinnern ist besonders an die Vajrasūci. 14) Vgl. die unten, Anm. 36, angeführten Stellen. - Zwar ist aller dharma in gewissem Sinne ,,je eigener dharma" (svadharman als Adjektiv schon Rgveda III, 21, 2), aber dies erhält in der Gitä doch einen neuen Akzent. [8]Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40