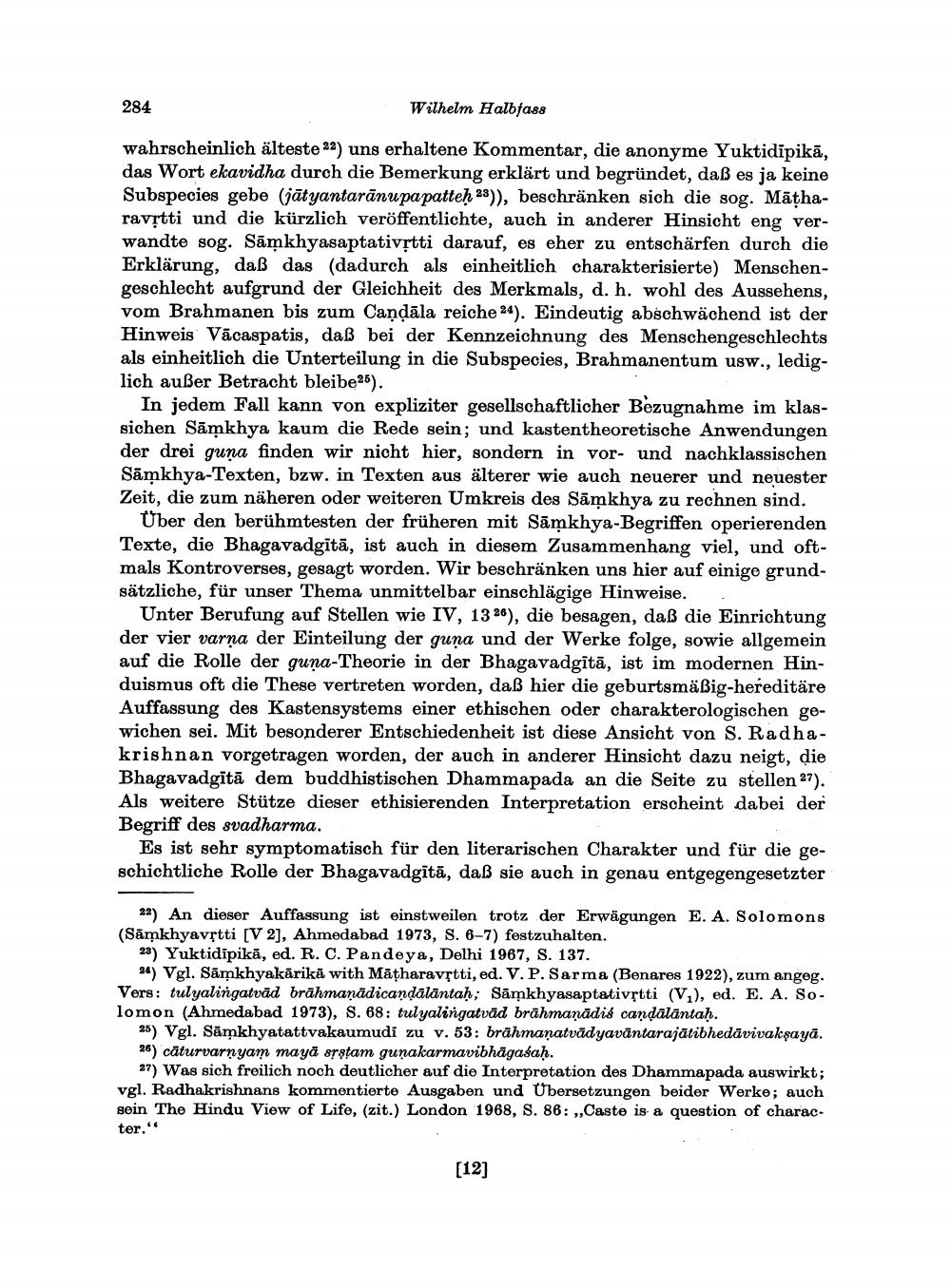Book Title: Zur Theorie Der Kastenordnung In Der Indischen Philosophie Author(s): Wilhelm Halbfass Publisher: Wilhelm Halbfass View full book textPage 8
________________ 284 Wilhelm Halbfa88 wahrscheinlich älteste 22) uns erhaltene Kommentar, die anonyme Yuktidipikā, das Wort ekavidha durch die Bemerkung erklärt und begründet, daß es ja keine Subspecies gebe (jātyantarānu pa patteḥ 23)), beschränken sich die sog. Mātharavịtti und die kürzlich veröffentlichte, auch in anderer Hinsicht eng verwandte sog. Sāmkhyasaptativịtti darauf, es eher zu entschärfen durch die Erklärung, daß das (dadurch als einheitlich charakterisierte) Menschengeschlecht aufgrund der Gleichheit des Merkmals, d. h. wohl des Aussehens, vom Brahmanen bis zum Candāla reiche 24). Eindeutig abschwächend ist der Hinweis Vācaspatis, daß bei der Kennzeichnung des Menschengeschlechts als einheitlich die Unterteilung in die Subspecies, Brahmanentum usw., lediglich außer Betracht bleibe25). In jedem Fall kann von expliziter gesellschaftlicher Bezugnahme im klassichen Sāmkhya kaum die Rede sein; und kastentheoretische Anwendungen der drei guna finden wir nicht hier, sondern in vor- und nachklassischen Sāmkhya-Texten, bzw. in Texten aus älterer wie auch neuerer und neuester Zeit, die zum näheren oder weiteren Umkreis des Sāmkhya zu rechnen sind. Uber den berühmtesten der früheren mit Sāmkhya-Begriffen operierenden Texte, die Bhagavadgitā, ist auch in diesem Zusammenhang viel, und oftmals Kontroverses, gesagt worden. Wir beschränken uns hier auf einige grundsätzliche, für unser Thema unmittelbar einschlägige Hinweise. Unter Berufung auf Stellen wie IV, 1326), die besagen, daß die Einrichtung der vier varna der Einteilung der guna und der Werke folge, sowie allgemein auf die Rolle der guna-Theorie in der Bhagavadgītā, ist im modernen Hinduismus oft die These vertreten worden, daß hier die geburtsmäßig-hereditäre Auffassung des Kastensystems einer ethischen oder charakterologischen gewichen sei. Mit besonderer Entschiedenheit ist diese Ansicht von S. Radhakrishnan vorgetragen worden, der auch in anderer Hinsicht dazu neigt, die Bhagavadgitā dem buddhistischen Dhammapada an die Seite zu stellen 27). Als weitere Stütze dieser ethisierenden Interpretation erscheint dabei der Begriff des svadharma. Es ist sehr symptomatisch für den literarischen Charakter und für die geschichtliche Rolle der Bhagavadgitā, daß sie auch in genau entgegengesetzter 22) An dieser Auffassung ist einstweilen trotz der Erwägungen E. A. Solomons (Samkhyavștti (V 2], Ahmedabad 1973, S. 6-7) festzuhalten. 23) Yuktidipikā, ed. R. C. Pandeya, Delhi 1967, S. 137. 24) Vgl. Samkhyakārikā with Mātharavṛtti, ed. V.P. Sarma (Benares 1922), zum angeg. Vers: tulyalingatvād brahmanādicandalāntah; Sāmkhyasaptativștti (V), ed. E. A. Solomon (Ahmedabad 1973), S. 68: tulyalingatvād brāhmaṇādis candalāntah. 25) Vgl. Samkhyatattvakaumudi zu v. 53: brāhmaṇatvād yavāntarajätibhedāvivakşayā. 26) cäturvarnyam mayā srstam gunakarmavibhāgasah. 27) Was sich freilich noch deutlicher auf die Interpretation des Dhammapada auswirkt; vgl. Radhakrishnans kommentierte Ausgaben und Übersetzungen beider Werke; auch sein The Hindu View of Life, (zit.) London 1968, S. 86: ,,Caste is a question of character, [12]Page Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40