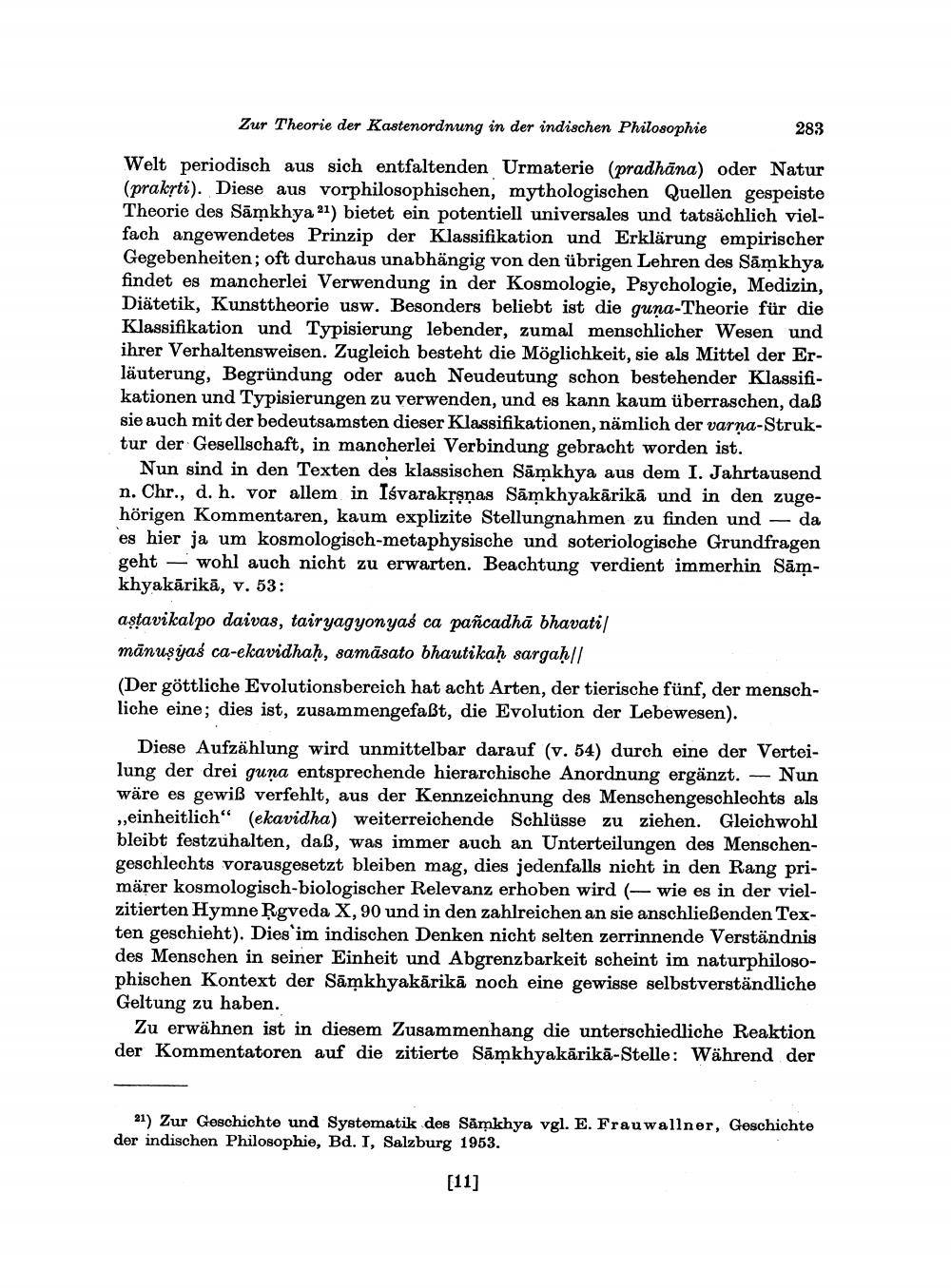Book Title: Zur Theorie Der Kastenordnung In Der Indischen Philosophie Author(s): Wilhelm Halbfass Publisher: Wilhelm Halbfass View full book textPage 7
________________ Zur Theorie der Kastenordnung in der indischen Philosophie 283 Welt periodisch aus sich entfaltenden Urmaterie (pradhāna) oder Natur (prakrti). Diese aus vorphilosophischen, mythologischen Quellen gespeiste Theorie des Sāmkhya 21) bietet ein potentiell universales und tatsächlich vielfach angewendetes Prinzip der Klassifikation und Erklärung empirischer Gegebenheiten; oft durchaus unabhängig von den übrigen Lehren des Sāņkhya findet es mancherlei Verwendung in der Kosmologie, Psychologie, Medizin, Diätetik, Kunsttheorie usw. Besonders beliebt ist die guna-Theorie für die Klassifikation und Typisierung lebender, zumal menschlicher Wesen und ihrer Verhaltensweisen. Zugleich besteht die Möglichkeit, sie als Mittel der Erläuterung, Begründung oder auch Neudeutung schon bestehender Klassifikationen und Typisierungen zu verwenden, und es kann kaum überraschen, daß sie auch mit der bedeutsamsten dieser Klassifikationen, nämlich der varna-Struktur der Gesellschaft, in mancherlei Verbindung gebracht worden ist. Nun sind in den Texten des klassischen Sāmkhya aus dem I. Jahrtausend n. Chr., d. h. vor allem in Isvarakrsnas Sāmkhyakārikā und in den zugehörigen Kommentaren, kaum explizite Stellungnahmen zu finden und — da es hier ja um kosmologisch-metaphysische und soteriologische Grundfragen geht – wohl auch nicht zu erwarten. Beachtung verdient immerhin Sāmkhyakārikā, v. 53: aştavikalpo daivas, tairyagyonyaś ca pañcadhā bhavati/ mänuşyas ca-ekavidhaḥ, samāsato bhautikaḥ sargah// (Der göttliche Evolutionsbereich hat acht Arten, der tierische fünf, der menschliche eine; dies ist, zusammengefaßt, die Evolution der Lebewesen). Diese Aufzählung wird unmittelbar darauf (v. 54) durch eine der Verteilung der drei guna entsprechende hierarchische Anordnung ergänzt. - Nun wäre es gewiß verfehlt, aus der Kennzeichnung des Menschengeschlechts als ,,einheitlich" (ekavidha) weiterreichende Schlüsse zu ziehen. Gleichwohl bleibt festzuhalten, daß, was immer auch an Unterteilungen des Menschengeschlechts vorausgesetzt bleiben mag, dies jedenfalls nicht in den Rang primärer kosmologisch-biologischer Relevanz erhoben wird ( wie es in der vielzitierten Hymne Rgveda X, 90 und in den zahlreichen an sie anschließenden Texten geschieht). Dies im indischen Denken nicht selten zerrinnende Verständnis des Menschen in seiner Einheit und Abgrenzbarkeit scheint im naturphilosophischen Kontext der Samkhyakārikā noch eine gewisse selbstverständliche Geltung zu haben. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die unterschiedliche Reaktion der Kommentatoren auf die zitierte Sāmkhyakārikā-Stelle: Während der 21) Zur Geschichte und Systematik des Sâmkhya vgl. E. Frau wallner, Geschichte der indischen Philosophie, Bd. I, Salzburg 1953. [11]Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40