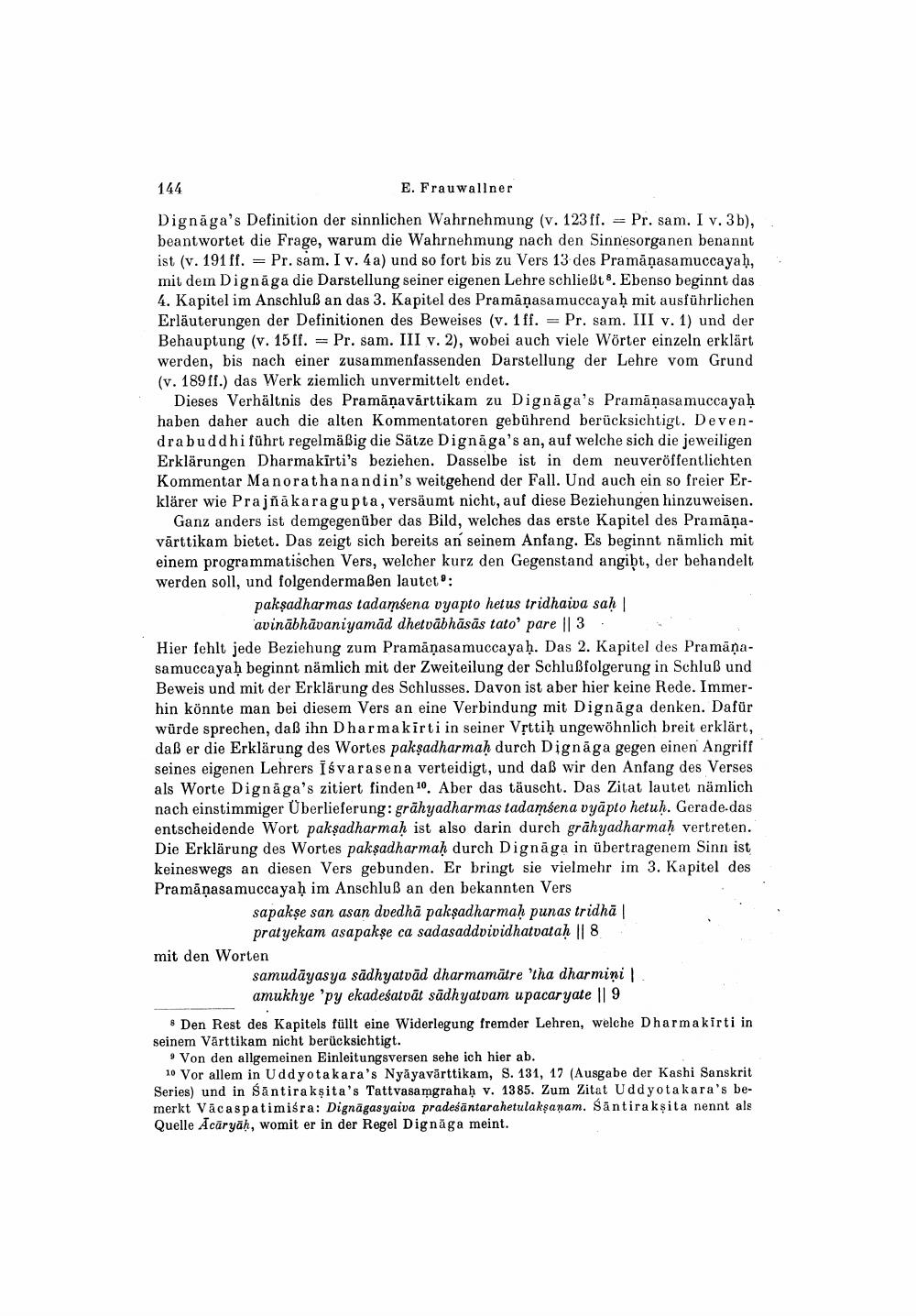Book Title: Die Reihenfolge Und Entstehung Der Werke Dharmakiritis Author(s): Erich Frauwallner Publisher: Erich Frauwallner View full book textPage 4
________________ 144 E. Frauwallner Dignaga's Definition der sinnlichen Wahrnehmung (v. 123 ff. Pr. sam. I v. 3b), beantwortet die Frage, warum die Wahrnehmung nach den Sinnesorganen benannt ist (v. 191 ff. Pr. sam. I v. 4a) und so fort bis zu Vers 13 des Pramāņasamuccayaḥ, mit dem Dignaga die Darstellung seiner eigenen Lehre schließt. Ebenso beginnt das 4. Kapitel im Anschluß an das 3. Kapitel des Pramāņasamuccayaḥ mit ausführlichen Erläuterungen der Definitionen des Beweises (v. 1 ff. Pr. sam. III v. 1) und der Behauptung (v. 15 ff. Pr. sam. III v. 2), wobei auch viele Wörter einzeln erklärt werden, bis nach einer zusammenfassenden Darstellung der Lehre vom Grund (v. 189 ff.) das Werk ziemlich unvermittelt endet. Dieses Verhältnis des Pramāṇavārttikam zu Dignāga's Pramāņasamuccayaḥ haben daher auch die alten Kommentatoren gebührend berücksichtigt. Devendrabuddhi führt regelmäßig die Sätze Dignaga's an, auf welche sich die jeweiligen Erklärungen Dharmakirti's beziehen. Dasselbe ist in dem neuveröffentlichten Kommentar Manorathanandin's weitgehend der Fall. Und auch ein so freier Erklärer wie Prajñā karagupta, versäumt nicht, auf diese Beziehungen hinzuweisen. Ganz anders ist demgegenüber das Bild, welches das erste Kapitel des Pramāņavārttikam bietet. Das zeigt sich bereits an seinem Anfang. Es beginnt nämlich mit einem programmatischen Vers, welcher kurz den Gegenstand angibt, der behandelt werden soll, und folgendermaßen lautet: pakṣadharmas tadamsena vyapto hetus tridhaiva saḥ | avinābhavaniyamād dhetvābhāsās tato' pare || 3 Hier fehlt jede Beziehung zum Pramāṇasamuccayaḥ. Das 2. Kapitel des Pramaṇasamuccayah beginnt nämlich mit der Zweiteilung der Schlußfolgerung in Schluß und Beweis und mit der Erklärung des Schlusses. Davon ist aber hier keine Rede. Immerhin könnte man bei diesem Vers an eine Verbindung mit Dignaga denken. Dafür würde sprechen, daß ihn Dharmakirti in seiner Vṛttiḥ ungewöhnlich breit erklärt, daß er die Erklärung des Wortes pakṣadharmaḥ durch Dignaga gegen einen Angriff seines eigenen Lehrers Isvarasena verteidigt, und daß wir den Anfang des Verses als Worte Dignaga's zitiert finden 10. Aber das täuscht. Das Zitat lautet nämlich nach einstimmiger Überlieferung: grähyadharmas tadamsena vyäpto hetuḥ. Gerade.das entscheidende Wort pakṣadharmaḥ ist also darin durch grahyadharmaḥ vertreten. Die Erklärung des Wortes pakṣadharmaḥ durch Dignaga in übertragenem Sinn ist keineswegs an diesen Vers gebunden. Er bringt sie vielmehr im 3. Kapitel des Pramāṇasamuccayaḥ im Anschluß an den bekannten Vers sapakṣe san asan dvedha pakṣadharmaḥ punas tridha | pratyekam asapakṣe ca sadasaddvividhatvataḥ || 8. mit den Worten samudayasya sadhyatvad dharmamätre 'tha dharmini | amukhye 'py ekadeśatvāt sadhyatvam upacaryate || 9 8 Den Rest des Kapitels füllt eine Widerlegung fremder Lehren, welche Dharmakirti in seinem Värttikam nicht berücksichtigt. Von den allgemeinen Einleitungsversen sehe ich hier ab. 10 Vor allem in Uddyotakara's Nyayavärttikam, S. 131, 17 (Ausgabe der Kashi Sanskrit Series) und in Śantirakṣita's Tattvasamgrahah v. 1385. Zum Zitat Uddyotakara's bemerkt Vacaspatimiśra: Dignagasyaiva pradesantarahetulakṣaṇam. Santirakṣita nennt als Quelle Acaryaḥ, womit er in der Regel Dignaga meint.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14