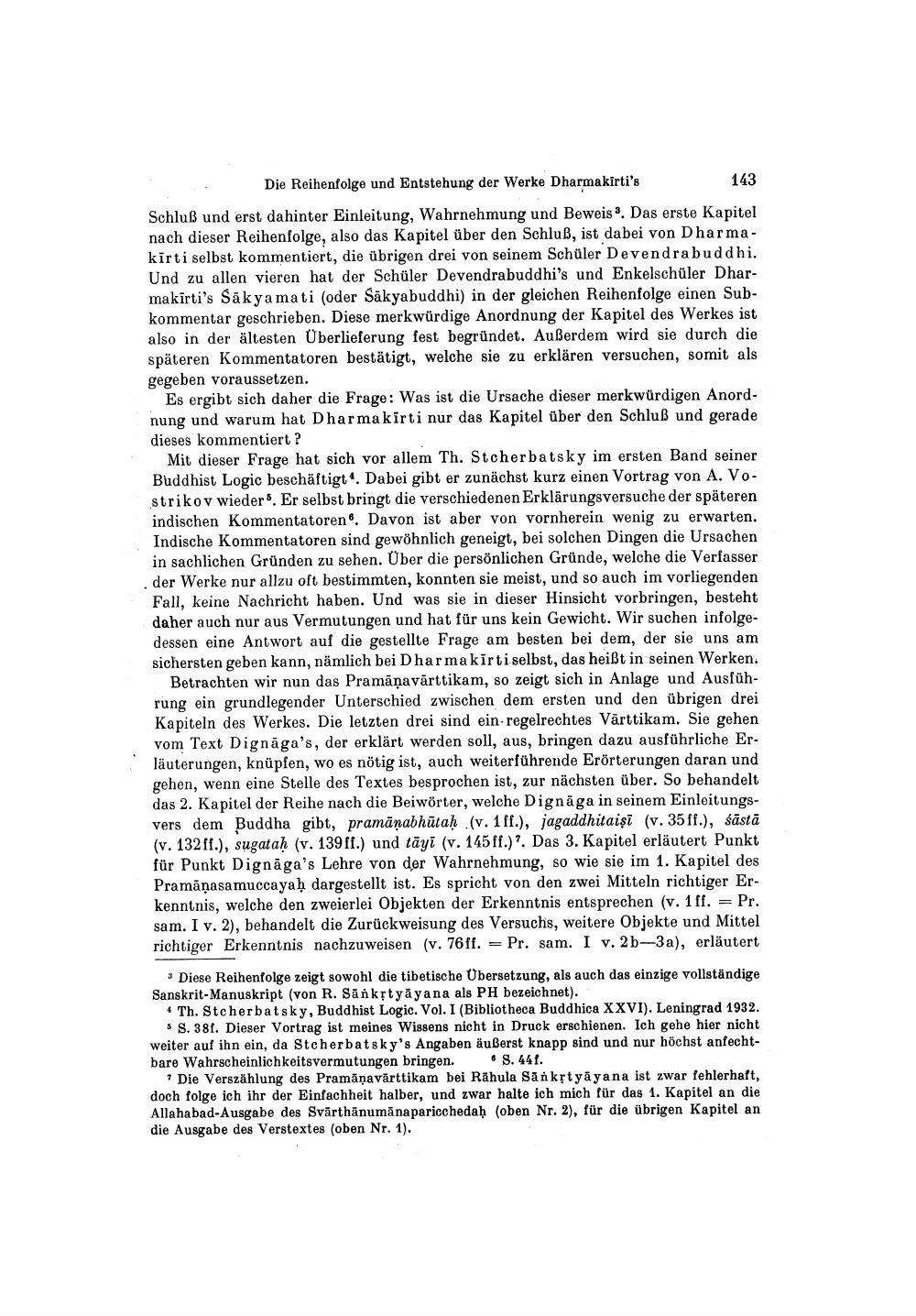Book Title: Die Reihenfolge Und Entstehung Der Werke Dharmakiritis Author(s): Erich Frauwallner Publisher: Erich Frauwallner View full book textPage 3
________________ Die Reihenfolge und Entstehung der Werke Dharmakirti's 143 Schluß und erst dahinter Einleitung, Wahrnehmung und Beweis. Das erste Kapitel nach dieser Reihenfolge, also das Kapitel über den Schluß, ist dabei von Dharmakirti selbst kommentiert, die übrigen drei von seinem Schüler Devendrabuddhi. Und zu allen vieren hat der Schüler Devendrabuddhi's und Enkelschüler Dharmakirti's Sākya mati (oder Sākyabuddhi) in der gleichen Reihenfolge einen Subkommentar geschrieben. Diese merkwürdige Anordnung der Kapitel des Werkes ist also in der ältesten Überlieferung fest begründet. Außerdem wird sie durch die späteren Kommentatoren bestätigt, welche sie zu erklären versuchen, somit als gegeben voraussetzen. Es ergibt sich daher die Frage: Was ist die Ursache dieser merkwürdigen Anordnung und warum hat Dharmakirti nur das Kapitel über den Schluß und gerade dieses kommentiert? Mit dieser Frage hat sich vor allem Th. Stcherbatsky im ersten Band seiner Buddhist Logic beschäftigt. Dabei gibt er zunächst kurz einen Vortrag von A. Vostrikov wieder. Er selbst bringt die verschiedenen Erklärungsversuche der späteren indischen Kommentatoren. Davon ist aber von vornherein wenig zu erwarten. Indische Kommentatoren sind gewöhnlich geneigt, bei solchen Dingen die Ursachen in sachlichen Gründen zu sehen. Über die persönlichen Gründe, welche die Verfasser der Werke nur allzu oft bestimmten, konnten sie meist, und so auch im vorliegenden Fall. keine Nachricht haben. Und was sie in dieser Hinsicht vorbringen, besteht daher auch nur aus Vermutungen und hat für uns kein Gewicht. Wir suchen infolgedessen eine Antwort auf die gestellte Frage am besten bei dem, der sie uns am sichersten geben kann, nämlich bei Dharmakirti selbst, das heißt in seinen Werken. Betrachten wir nun das Pramāņavārttikam, so zeigt sich in Anlage und Ausführung ein grundlegender Unterschied zwischen dem ersten und den übrigen drei Kapiteln des Werkes. Die letzten drei sind ein regelrechtes Vārttikam. Sie gehen vom Text Dignāga's, der erklärt werden soll, aus, bringen dazu ausführliche Erläuterungen, knüpfen, wo es nötig ist, auch weiterführende Erörterungen daran und gehen, wenn eine Stelle des Textes besprochen ist, zur nächsten über. So behandelt das 2. Kapitel der Reihe nach die Beiwörter, welche Dignāga in seinem Einleitungsvers dem Buddha gibt, pramāṇabhūtah (v. 1 ff.), jagaddhitaişi (v. 35 ff.), śāstā (v. 132 ff.), sugataḥ (v. 139ff.) und tāyī (v. 145ff.)?. Das 3. Kapitel erläutert Punkt für Punkt Dignāga's Lehre von der Wahrnehmung, so wie sie im 1. Kapitel des Pramāṇasamuccayaḥ dargestellt ist. Es spricht von den zwei Mitteln richtiger Erkenntnis, welche den zweierlei Objekten der Erkenntnis entsprechen (v. 1 ff. = Pr. sam. I v. 2), behandelt die Zurückweisung des Versuchs, weitere Objekte und Mittel richtiger Erkenntnis nachzuweisen (v. 76 ff. = Pr. sam. I v. 2b-3a), erläutert Diese Reihenfolge zeigt sowohl die tibetische Übersetzung, als auch das einzige vollständige Sanskrit-Manuskript (von R. Sankrtyāyana als PH bezeichnet). Th. Stcherbatsky, Buddhist Logic. Vol. I (Bibliotheca Buddhica XXVI). Leningrad 1932. SS. 38f. Dieser Vortrag ist meines Wissens nicht in Druck erschienen. Ich gehe hier nicht weiter auf ihn ein, da Stcherbatsky's Angaben äußerst knapp sind und nur höchst anfechtbare Wahrscheinlichkeitsvermutungen bringen. S. 441. ? Die Verszählung des Pramāņavārttikam bei Rāhula Sankstyāyana ist zwar fehlerhaft, doch folge ich ihr der Einfachheit halber, und zwar halte ich mich für das 1. Kapitel an die Allahabad-Ausgabe des Svārthānumānaparicchedaḥ (oben Nr. 2), für die übrigen Kapitel an die Ausgabe des Verstextes (oben Nr. 1).Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14