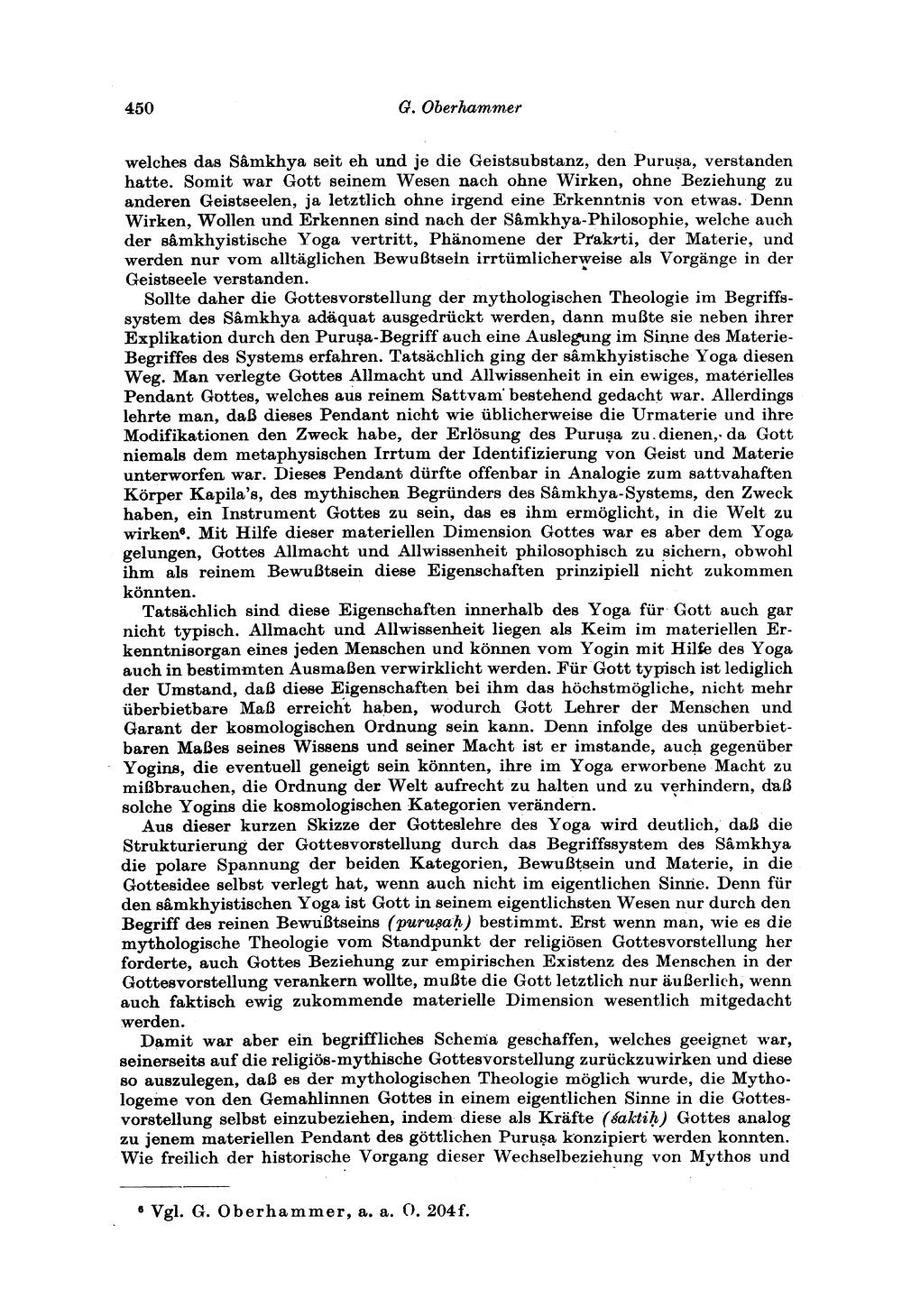Book Title: Die Gottesidee In Der Indischen Philosophie Des Ersten Nachchristlichen Jahrtausends Author(s): Gerhard Oberhammer Publisher: Gerhard Oberhammer View full book textPage 4
________________ 450 G. Oberhammer welches das Sâmkhya seit eh und je die Geistsubstanz, den Purusa, verstanden hatte. Somit war Gott seinem Wesen nach ohne Wirken, ohne Beziehung zu anderen Geistseelen, ja letztlich ohne irgend eine Erkenntnis von etwas. Denn Wirken, Wollen und Erkennen sind nach der Sâmkhya-Philosophie, welche auch der sâmkhyistische Yoga vertritt, Phänomene der Prakrti, der Materie, und werden nur vom alltäglichen Bewußtsein irrtümlicherweise als Vorgänge in der Geistseele verstanden. Sollte daher die Gottesvorstellung der mythologischen Theologie im Begriffssystem des Sâmkhya adäquat ausgedrückt werden, dann mußte sie neben ihrer Explikation durch den Puruşa-Begriff auch eine Auslegung im Sinne des MaterieBegriffes des Systems erfahren. Tatsächlich ging der sâmkhyistische Yoga diesen Weg. Man verlegte Gottes Allmacht und Allwissenheit in ein ewiges, materielles Pendant Gottes, welches aus reinem Sattvam' bestehend gedacht war. Allerdings lehrte man, daß dieses Pendant nicht wie üblicherweise die Urmaterie und ihre Modifikationen den Zweck habe, der Erlösung des Puruşa zu dienen, da Gott niemals dem metaphysischen Irrtum der Identifizierung von Geist und Materie unterworfen war. Dieses Pendant dürfte offenbar in Analogie zum sattvahaften Körper Kapila's, des mythischen Begründers des Sâmkhya-Systems, den Zweck haben, ein Instrument Gottes zu sein, das es ihm ermöglicht, in die Welt zu wirken. Mit Hilfe dieser materiellen Dimension Gottes war es aber dem Yoga gelungen, Gottes Allmacht und Allwissenheit philosophisch zu sichern, obwohl ihm als reinem Bewußtsein diese Eigenschaften prinzipiell nicht zukommen könnten. Tatsächlich sind diese Eigenschaften innerhalb des Yoga für Gott auch gar nicht typisch. Allmacht und Allwissenheit liegen als Keim im materiellen Erkenntnisorgan eines jeden Menschen und können vom Yogin mit Hilfe des Yoga auch in bestimmten Ausmaßen verwirklicht werden. Für Gott typisch ist lediglich der Umstand, daß diese Eigenschaften bei ihm das höchstmögliche, nicht mehr überbietbare Maß erreicht haben, wodurch Gott Lehrer der Menschen und Garant der kosmologischen Ordnung sein kann. Denn infolge des unüberbietbaren Maßes seines Wissens und seiner Macht ist er imstande, auch gegenüber Yogins, die eventuell geneigt sein könnten, ihre im Yoga erworbene Macht zu mißbrauchen, die Ordnung der Welt aufrecht zu halten und zu verhindern, daß solche Yogins die kosmologischen Kategorien verändern. Aus dieser kurzen Skizze der Gotteslehre des Yoga wird deutlich, daß die Strukturierung der Gottesvorstellung durch das Begriffssystem des Sâmkhya die polare Spannung der beiden Kategorien, Bewußtsein und Materie, in die Gottesidee selbst verlegt hat, wenn auch nicht im eigentlichen Sinne. Denn für den sâmkhyistischen Yoga ist Gott in seinem eigentlichsten Wesen nur durch den Begriff des reinen Bewußtseins (purusah) bestimmt. Erst wenn man, wie es die mythologische Theologie vom Standpunkt der religiösen Gottesvorstellung her forderte, auch Gottes Beziehung zur empirischen Existenz des Menschen in der Gottesvorstellung verankern wollte, mußte die Gott letztlich nur äußerlich, wenn auch faktisch ewig zukommende materielle Dimension wesentlich mitgedacht werden. Damit war aber ein begriffliches Schema geschaffen, welches geeignet war, seinerseits auf die religiös-mythische Gottesvorstellung zurückzuwirken und diese so auszulegen, daß es der mythologischen Theologie möglich wurde, die Mythologeme von den Gemahlinnen Gottes in einem eigentlichen Sinne in die Gottesvorstellung selbst einzubeziehen, indem diese als Kräfte (saktih) Gottes analog zu jenem materiellen Pendant des göttlichen Puruşa konzipiert werden konnten. Wie freilich der historische Vorgang dieser Wechselbeziehung von Mythos und * Vgl. G. Oberhammer, a. a. 0. 204 f.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11