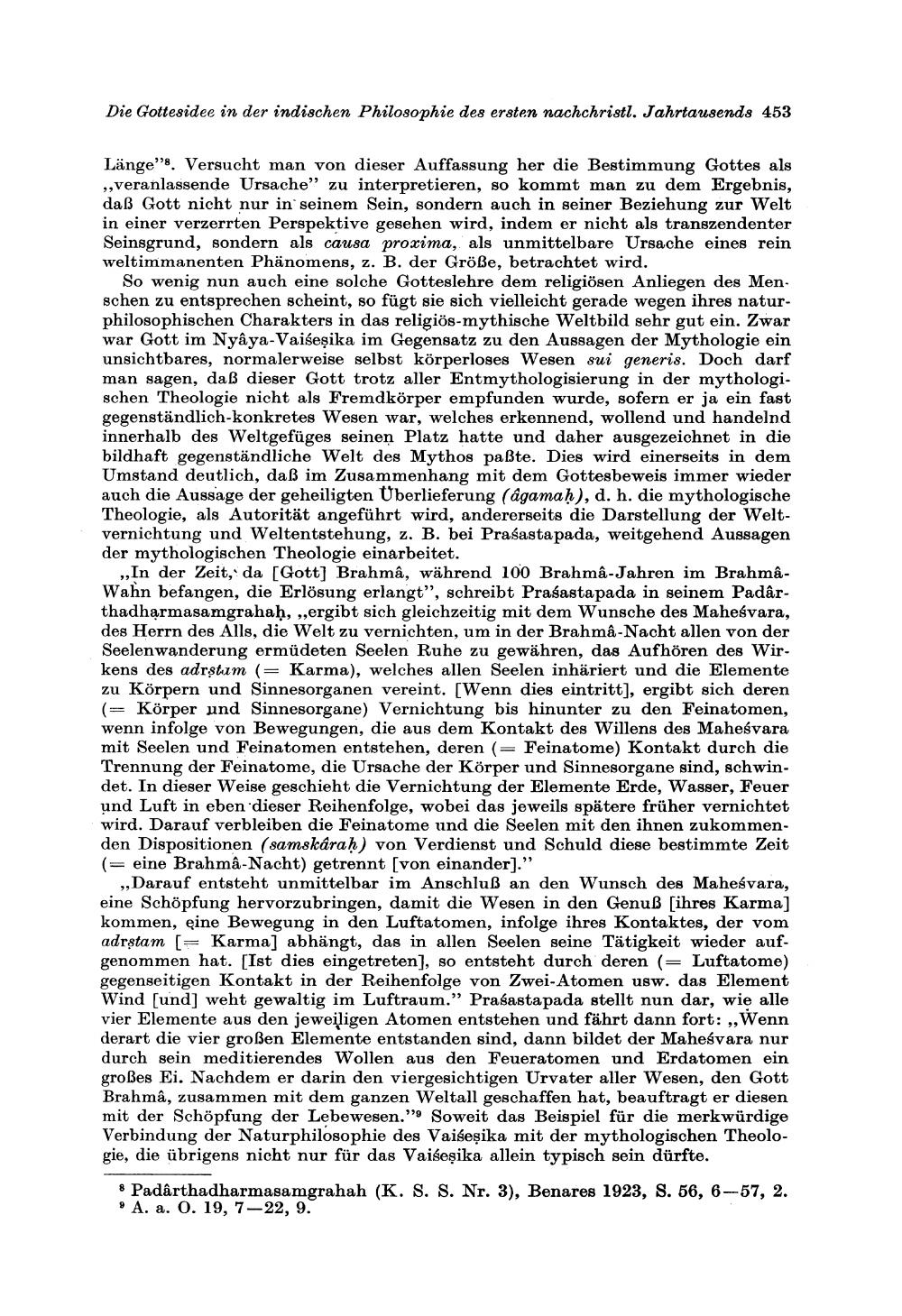Book Title: Die Gottesidee In Der Indischen Philosophie Des Ersten Nachchristlichen Jahrtausends Author(s): Gerhard Oberhammer Publisher: Gerhard Oberhammer View full book textPage 7
________________ Die Gottesidee in der indischen Philosophie des ersten nachchristl. Jahrtausends 453 Länge". Versucht man von dieser Auffassung her die Bestimmung Gottes als „veranlassende Ursache" zu interpretieren, so kommt man zu dem Ergebnis, daß Gott nicht nur in seinem Sein, sondern auch in seiner Beziehung zur Welt in einer verzerrten Perspektive gesehen wird, indem er nicht als transzendenter Seinsgrund, sondern als causa proxima, als unmittelbare Ursache eines rein weltimmanenten Phänomens, z. B. der Größe, betrachtet wird. So wenig nun auch eine solche Gotteslehre dem religiösen Anliegen des Menschen zu entsprechen scheint, so fügt sie sich vielleicht gerade wegen ihres naturphilosophischen Charakters in das religiös-mythische Weltbild sehr gut ein. Zwar war Gott im Nyâya-Vaiseşika im Gegensatz zu den Aussagen der Mythologie ein unsichtbares, normalerweise selbst körperloses Wesen sui generis. Doch darf man sagen, daß dieser Gott trotz aller Entmythologisierung in der mythologischen Theologie nicht als Fremdkörper empfunden wurde, sofern er ja ein fast gegenständlich-konkretes Wesen war, welches erkennend, wollend und handelnd innerhalb des Weltgefüges seinen Platz hatte und daher ausgezeichnet in die bildhaft gegenständliche Welt des Mythos paßte. Dies wird einerseits in dem Umstand deutlich, daß im Zusammenhang mit dem Gottesbeweis immer wieder auch die Aussage der geheiligten Uberlieferung (agamah), d. h. die mythologische Theologie, als Autorität angeführt wird, andererseits die Darstellung der Weltvernichtung und Weltentstehung, z. B. bei Prasastapada, weitgehend Aussagen der mythologischen Theologie einarbeitet. ,,In der Zeit, da [Gott] Brahmâ, während 100 Brahma-Jahren im BrahmaWahn befangen, die Erlösung erlangt", schreibt Prasastapada in seinem Padarthadhạrmasamgrahaḥ, „ergibt sich gleichzeitig mit dem Wunsche des Maheśvara, des Herrn des Alls, die Welt zu vernichten, um in der Brahma-Nacht allen von der Seelenwanderung ermüdeten Seelen Ruhe zu gewähren, das Aufhören des Wirkens des adrstam (= Karma), welches allen Seelen inhäriert und die Elemente zu Körpern und Sinnesorganen vereint. (Wenn dies eintritt], ergibt sich deren (= Körper und Sinnesorgane) Vernichtung bis hinunter zu den Feinatomen, wenn infolge von Bewegungen, die aus dem Kontakt des Willens des Maheśvara mit Seelen und Feinatomen entstehen, deren (= Feinatome) Kontakt durch die Trennung der Feinatome, die Ursache der Körper und Sinnesorgane sind, schwindet. In dieser Weise geschieht die Vernichtung der Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft in eben dieser Reihenfolge, wobei das jeweils spätere früher vernichtet wird. Darauf verbleiben die Feinatome und die Seelen mit den ihnen zukommen. den Dispositionen (samskärah) von Verdienst und Schuld diese bestimmte Zeit (= eine Brahmâ-Nacht) getrennt [von einander]." ,,Darauf entsteht unmittelbar im Anschluß an den Wunsch des Maheśvara, eine Schöpfung hervorzubringen, damit die Wesen in den Genuß ihres Karma) kommen, eine Bewegung in den Luftatomen, infolge ihres Kontaktes, der vom adrstam (= Karma] abhängt, das in allen Seelen seine Tätigkeit wieder aufgenommen hat. Ist dies eingetreten), so entsteht durch deren (= Luftatome) gegenseitigen Kontakt in der Reihenfolge von Zwei-Atomen usw. das Element Wind [und] weht gewaltig im Luftraum." Prasastapada stellt nun dar, wie alle vier Elemente aus den jeweiligen Atomen entstehen und fährt dann fort: ,,Wenn derart die vier großen Elemente entstanden sind, dann bildet der Maheśvara nur durch sein meditierendes Wollen aus den Feueratomen und Erdatomen ein großes Ei. Nachdem er darin den viergesichtigen Urvater aller Wesen, den Gott Brahma, zusammen mit dem ganzen Weltall geschaffen hat, beauftragt er diesen mit der Schöpfung der Lebewesen." Soweit das Beispiel für die merkwürdige Verbindung der Naturphilosophie des Vaiseșika mit der mythologischen Theologie, die übrigens nicht nur für das Vaišeșika allein typisch sein dürfte. 8 Padârthadharmasamgrahah (K. S. S. Nr. 3), Benares 1923, S. 56, 6-57, 2. A. a. 0. 19, 7-22, 9.Page Navigation
1 ... 5 6 7 8 9 10 11