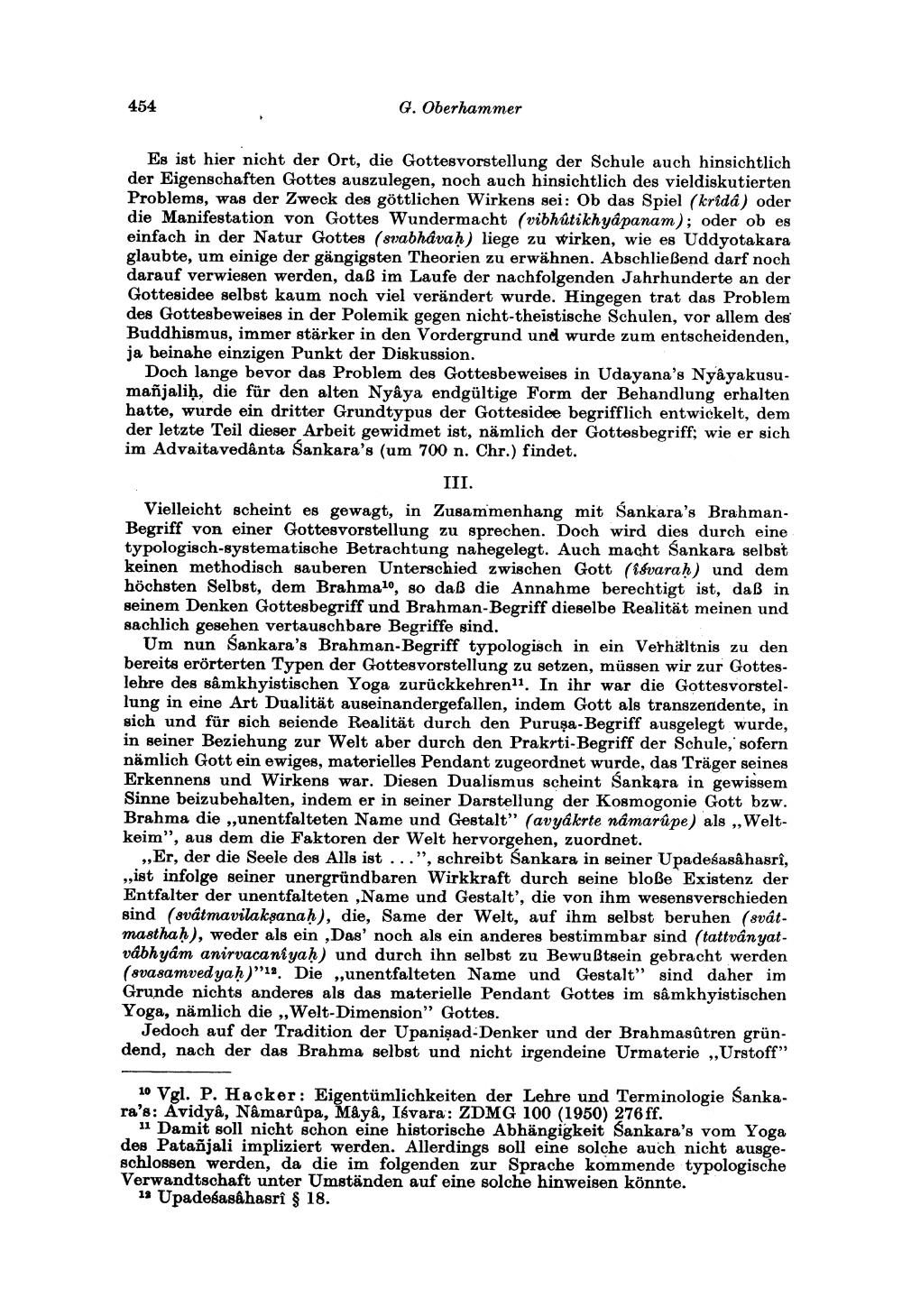Book Title: Die Gottesidee In Der Indischen Philosophie Des Ersten Nachchristlichen Jahrtausends Author(s): Gerhard Oberhammer Publisher: Gerhard Oberhammer View full book textPage 8
________________ 454 G. Oberhammer Es ist hier nicht der Ort, die Gottesvorstellung der Schule auch hinsichtlich der Eigenschaften Gottes auszulegen, noch auch hinsichtlich des vieldiskutierten Problems, was der Zweck des göttlichen Wirkens sei: Ob das Spiel (kridá) oder die Manifestation von Gottes Wundermacht (vibhatikhyapanam); oder ob es einfach in der Natur Gottes (svabhavah) liege zu wirken, wie es Uddyotakara glaubte, um einige der gängigsten Theorien zu erwähnen. Abschließend darf noch darauf verwiesen werden, daß im Laufe der nachfolgenden Jahrhunderte an der Gottesidee selbst kaum noch viel verändert wurde. Hingegen trat das Problem des Gottesbeweises in der Polemik gegen nicht-theistische Schulen, vor allem des Buddhismus, immer stärker in den Vordergrund und wurde zum entscheidenden, ja beinahe einzigen Punkt der Diskussion. Doch lange bevor das Problem des Gottesbeweises in Udayana's Nyâyakusumañjaliḥ, die für den alten Nyâya endgültige Form der Behandlung erhalten hatte, wurde ein dritter Grundtypus der Gottesidee begrifflich entwickelt, dem der letzte Teil dieser Arbeit gewidmet ist, nämlich der Gottesbegriff; wie er sich im Advaitavedânta Sankara's (um 700 n. Chr.) findet. III. Vielleicht scheint es gewagt, in Zusammenhang mit Sankara's BrahmanBegriff von einer Gottesvorstellung zu sprechen. Doch wird dies durch eine typologisch-systematische Betrachtung nahegelegt. Auch macht Sankara selbst keinen methodisch sauberen Unterschied zwischen Gott (isvarah) und dem höchsten Selbst, dem Brahma10, so daß die Annahme berechtigt ist, daß in seinem Denken Gottesbegriff und Brahman-Begriff dieselbe Realität meinen und sachlich gesehen vertauschbare Begriffe sind. Um nun Sankara's Brahman-Begriff typologisch in ein Verhältnis zu den bereits erörterten Typen der Gottesvorstellung zu setzen, müssen wir zur Gotteslehre des sâmkhyistischen Yoga zurückkehren". In ihr war die Gottesvorstellung in eine Art Dualität auseinandergefallen, indem Gott als transzendente, in sich und für sich seiende Realität durch den Puruşa-Begriff ausgelegt wurde, in seiner Beziehung zur Welt aber durch den Prakrti-Begriff der Schule, sofern nämlich Gott ein ewiges, materielles Pendant zugeordnet wurde, das Träger seines Erkennens und Wirkens war. Diesen Dualismus scheint Sankara in gewissem Sinne beizubehalten, indem er in seiner Darstellung der Kosmogonie Gott bzw. Brahma die ,,unentfalteten Name und Gestalt" (avyákrte nâmarûpe) als ,,Weltkeim”, aus dem die Faktoren der Welt hervorgehen, zuordnet. ,,Er, der die Seele des Alls ist ...", schreibt Sankara in seiner Upadeśasahasri, ,,ist infolge seiner unergründbaren Wirkkraft durch seine bloße Existenz der Entfalter der unentfalteten ,Name und Gestalt', die von ihm wesensverschieden sind (svátmavilaksanah), die, Same der Welt, auf ihm selbst beruhen (svátmasthah), weder als ein ,Das' noch als ein anderes bestimmbar sind (tattványatvábhyam anirvacaniyah) und durch ihn selbst zu Bewußtsein gebracht werden (svasamved yah)”13. Die ,unentfalteten Name und Gestalt" sind daher im Grunde nichts anderes als das materielle Pendant Gottes im sâmkhyistischen Yoga, nämlich die ,,Welt-Dimension" Gottes. Jedoch auf der Tradition der Upanişad-Denker und der Brahmasûtren gründend, nach der das Brahma selbst und nicht irgendeine Urmaterie „Urstoff" 10 Vgl. P. Hacker: Eigentümlichkeiten der Lehre und Terminologie Sankara's: Avidyâ, Nâmarûpa. Må vå. Isvara: ZDMG 100 (1950) 276 ff. 11 Damit soll nicht schon eine historische Abhängigkeit Sankara's vom Yoga des Patañjali impliziert werden. Allerdings soll eine solche auch nicht ausgeschlossen werden, da die im folgenden zur Sprache kommende typologische Verwandtschaft unter Umständen auf eine solche hinweisen könnte. 19 Upadebasahasri & 18.Page Navigation
1 ... 6 7 8 9 10 11