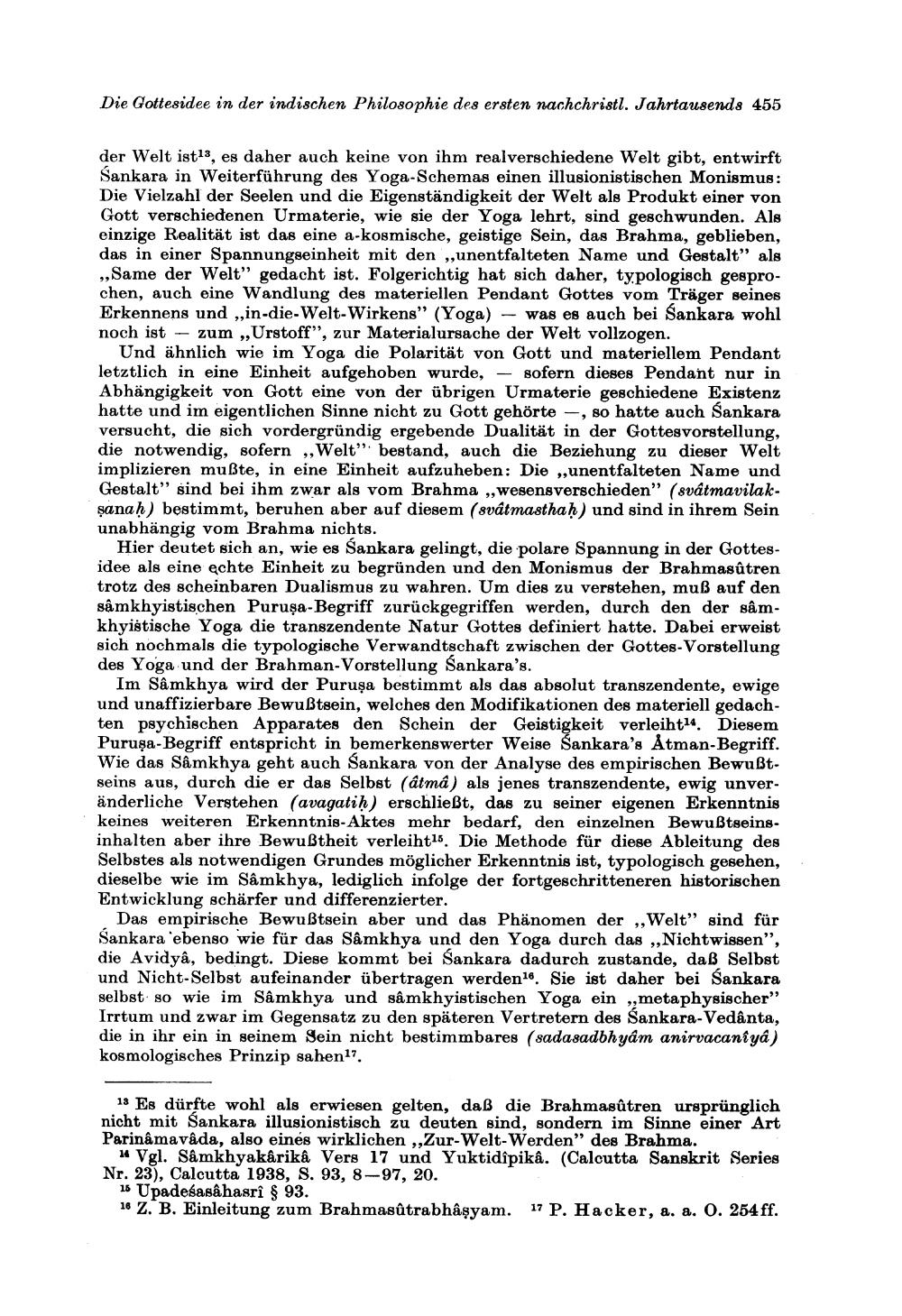Book Title: Die Gottesidee In Der Indischen Philosophie Des Ersten Nachchristlichen Jahrtausends Author(s): Gerhard Oberhammer Publisher: Gerhard Oberhammer View full book textPage 9
________________ Die Gottesidee in der indischen Philosophie des ersten nachchristl. Jahrtausends 455 der Welt ist13, es daher auch keine von ihm realverschiedene Welt gibt, entwirft Sankara in Weiterführung des Yoga-Schemas einen illusionistischen Monismus: Die Vielzahl der Seelen und die Eigenständigkeit der Welt als Produkt einer von Gott verschiedenen Urmaterie, wie sie der Yoga lehrt, sind geschwunden. Als einzige Realität ist das eine a-kosmische, geistige Sein, das Brahma, geblieben, das in einer Spannungseinheit mit den ,,unentfalteten Name und Gestalt" als ,,Same der Welt" gedacht ist. Folgerichtig hat sich daher, typologisch gesprochen, auch eine Wandlung des materiellen Pendant Gottes vom Träger seines Erkennens und ,,in-die-Welt-Wirkens" (Yoga) - was es auch bei Sankara wohl noch ist – zum „Urstoff", zur Materialursache der Welt vollzogen. Und ähnlich wie im Yoga die Polarität von Gott und materiellem Pendant letztlich in eine Einheit aufgehoben wurde, sofern dieses Pendant nur in Abhängigkeit von Gott eine von der übrigen Urmaterie geschiedene Existenz hatte und im eigentlichen Sinne nicht zu Gott gehörte -, so hatte auch Sankara versucht, die sich vordergründig ergebende Dualität in der Gottesvorstellung, die notwendig, sofern ,,Welt" bestand, auch die Beziehung zu dieser Welt implizieren mußte, in eine Einheit aufzuheben: Die ,,unentfalteten Name und Gestalt" sind bei ihm zwar als vom Brahma ,,wesensverschieden" (svátmavilakşanah) bestimmt, beruhen aber auf diesem (svátmasthah) und sind in ihrem Sein unabhängig vom Brahma nichts. Hier deutet sich an, wie es Sankara gelingt, die polare Spannung in der Gottesidee als eine echte Einheit zu begründen und den Monismus der Brahmasútren trotz des scheinbaren Dualismus zu wahren. Um dies zu verstehen, muß auf den sâmkhyistischen Puruşa-Begriff zurückgegriffen werden, durch den der sâmkhyistische Yoga die transzendente Natur Gottes definiert hatte. Dabei erweist sich nochmals die typologische Verwandtschaft zwischen der Gottes-Vorstellung des Yoga und der Brahman-Vorstellung Sankara's. Im Sâmkhya wird der Puruşa bestimmt als das absolut transzendente, ewige und unaffizierbare Bewußtsein, welches den Modifikationen des materiell gedachten psychischen Apparates den Schein der Geistigkeit verleiht14. Diesem Puruşa-Begriff entspricht in bemerkenswerter Weise Sankara's Atman Begriff. Wie das Sâmkhya geht auch Sankara von der Analyse des empirischen Bewußt. seins aus, durch die er das Selbst (átmá) als jenes transzendente, ewig unveränderliche Verstehen (avagatih) erschließt, das zu seiner eigenen Erkenntnis keines weiteren Erkenntnis-Aktes mehr bedarf, den einzelnen Bewußtseins. inhalten aber ihre Bewustheit verleiht15. Die Methode für diese Ableitung des Selbstes als notwendigen Grundes möglicher Erkenntnis ist, typologisch gesehen, dieselbe wie im Sâmkhya, lediglich infolge der fortgeschritteneren historischen Entwicklung schärfer und differenzierter. Das empirische Bewußtsein aber und das Phänomen der „Welt" sind für Sankara ebenso wie für das Sâmkhya und den Yoga durch das „Nichtwissen", die Avidya, bedingt. Diese kommt bei Sankara dadurch zustande, daß Selbst und Nicht-Selbst aufeinander übertragen werden 16. Sie ist daher bei Sankara selbst so wie im Sâmkhya und sâmkhyistischen Yoga ein , metaphysischer" Irrtum und zwar im Gegensatz zu den späteren Vertretern des Sankara-Vedanta, die in ihr ein in seinem Sein nicht bestimmbares (sadasadbhyam anirvacaniya) kosmologisches Prinzip sahen??. 13 Es dürfte wohl als erwiesen gelten, daß die Brahmasîtren ursprünglich nicht mit Sankara illusionistisch zu deuten sind, sondern im Sinne einer Art Parinâmavâda, also eines wirklichen ,,Zur-Welt-Werden" des Brahma. * Vgl. Samkhyakârika Vers 17 und Yuktidîpikâ. (Calcutta Sanskrit Series Nr. 23), Calcutta 1938, S. 93, 8-97, 20. 15 Upadesasâ hasrî $ 93. 16 Z. B. Einleitung zum Brahmasûtrabhâsyam. 7 P. Hacker, a. a. 0. 254 ff.Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11