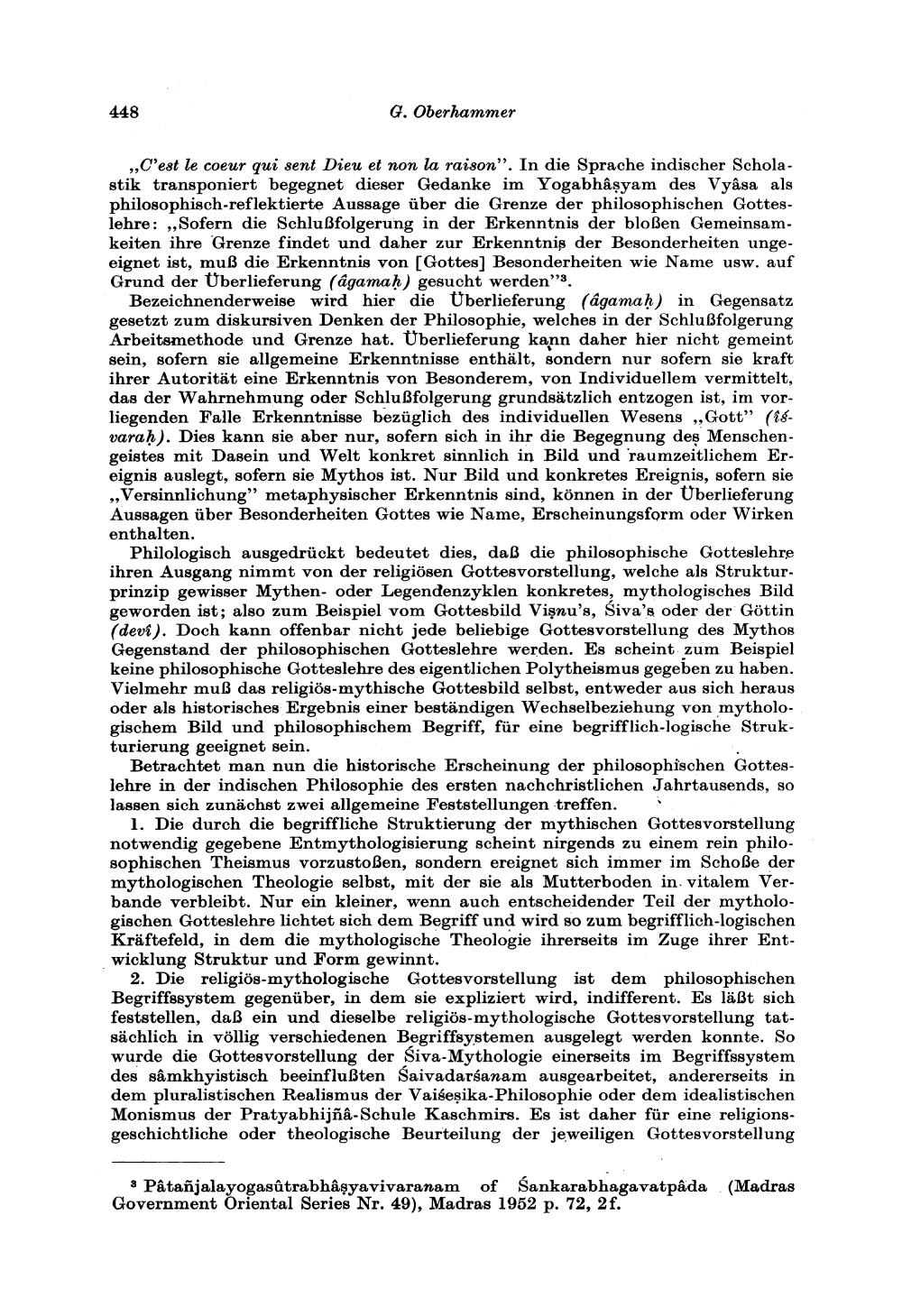Book Title: Die Gottesidee In Der Indischen Philosophie Des Ersten Nachchristlichen Jahrtausends Author(s): Gerhard Oberhammer Publisher: Gerhard Oberhammer View full book textPage 2
________________ 448 G. Oberhammer „C'est le coeur qui sent Dieu et non la raison". In die Sprache indischer Scholastik transponiert begegnet dieser Gedanke im Yogabhâsyam des Vyâsa als philosophisch-reflektierte Aussage über die Grenze der philosophischen Gotteslehre: ,,Sofern die Schlußfolgerung in der Erkenntnis der bloßen Gemeinsamkeiten ihre Grenze findet und daher zur Erkenntnis der Besonderheiten ungeeignet ist, muß die Erkenntnis von [Gottes) Besonderheiten wie Name usw. auf Grund der Überlieferung (agamah) gesucht werden". Bezeichnenderweise wird hier die Überlieferung (agamah) in Gegensatz gesetzt zum diskursiven Denken der Philosophie, welches in der Schlußfolgerung Arbeitsmethode und Grenze hat. Überlieferung kann daher hier nicht gemeint sein, sofern sie allgemeine Erkenntnisse enthält, sondern nur sofern sie kraft ihrer Autorität eine Erkenntnis von Besonderem, von Individuellem vermittelt, das der Wahrnehmung oder Schlußfolgerung grundsätzlich entzogen ist, im vorliegenden Falle Erkenntnisse bezüglich des individuellen Wesens „Gott" (isvarah). Dies kann sie aber nur, sofern sich in ihr die Begegnung des Menschengeistes mit Dasein und Welt konkret sinnlich in Bild und raumzeitlichem Ereignis auslegt, sofern sie Mythos ist. Nur Bild und konkretes Ereignis, sofern sie „Versinnlichung" metaphysischer Erkenntnis sind, können in der Überlieferung Aussagen über Besonderheiten Gottes wie Name, Erscheinungsform oder Wirken enthalten. Philologisch ausgedrückt bedeutet dies, daß die philosophische Gotteslehre ihren Ausgang nimmt von der religiösen Gottesvorstellung, welche als Strukturprinzip gewisser Mythen- oder Legendenzyklen konkretes, mythologisches Bild geworden ist; also zum Beispiel vom Gottesbild Vişnu's, Siva's oder der Göttin (devi). Doch kann offenbar nicht jede beliebige Gottesvorstellung des Mythos Gegenstand der philosophischen Gotteslehre werden. Es scheint zum Beispiel keine philosophische Gotteslehre des eigentlichen Polytheismus gegeben zu haben. Vielmehr muß das religiös-mythische Gottesbild selbst, entweder aus sich heraus oder als historisches Ergebnis einer beständigen Wechselbeziehung von mythologischem Bild und philosophischem Begriff, für eine begrifflich-logische Strukturierung geeignet sein. Betrachtet man nun die historische Erscheinung der philosophischen Gotteslehre in der indischen Philosophie des ersten nachchristlichen Jahrtausends, so lassen sich zunächst zwei allgemeine Feststellungen treffen. 1. Die durch die begriffliche Struktierung der mythischen Gottesvorstellung notwendig gegebene Entmythologisierung scheint nirgends zu einem rein philosophischen Theismus vorzustoßen, sondern ereignet sich immer im Schoße der mythologischen Theologie selbst, mit der sie als Mutterboden in vitalem Verbande verbleibt. Nur ein kleiner, wenn auch entscheidender Teil der mythologischen Gotteslehre lichtet sich dem Begriff und wird so zum begrifflich-logischen Kräftefeld, in dem die mythologische Theologie ihrerseits im Zuge ihrer Entwicklung Struktur und Form gewinnt. 2. Die religiös-mythologische Gottes vorstellung ist dem philosophischen Begriffssystem gegenüber, in dem sie expliziert wird, indifferent. Es läßt sich feststellen, daß ein und dieselbe religiös-mythologische Gottes vorstellung tatsächlich in völlig verschiedenen Begriffsystemen ausgelegt werden konnte. So wurde die Gottes vorstellung der Siva-Mythologie einerseits im Begriffssystem des sâmkhyistisch beeinflußten Saivadarśanam ausgearbeitet, andererseits in dem pluralistischen Realismus der Vaišeşika-Philosophie oder dem idealistischen Monismus der Pratyabhijña-Schule Kaschmirs. Es ist daher für eine religionsgeschichtliche oder theologische Beurteilung der jeweiligen Gottesvorstellung 3 Patañjalayogasútrabhâşyavivaranam of Sankarabhagavatpâda (Madras Government Oriental Series Nr. 49), Madras 1952 p. 72, 2f.Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11