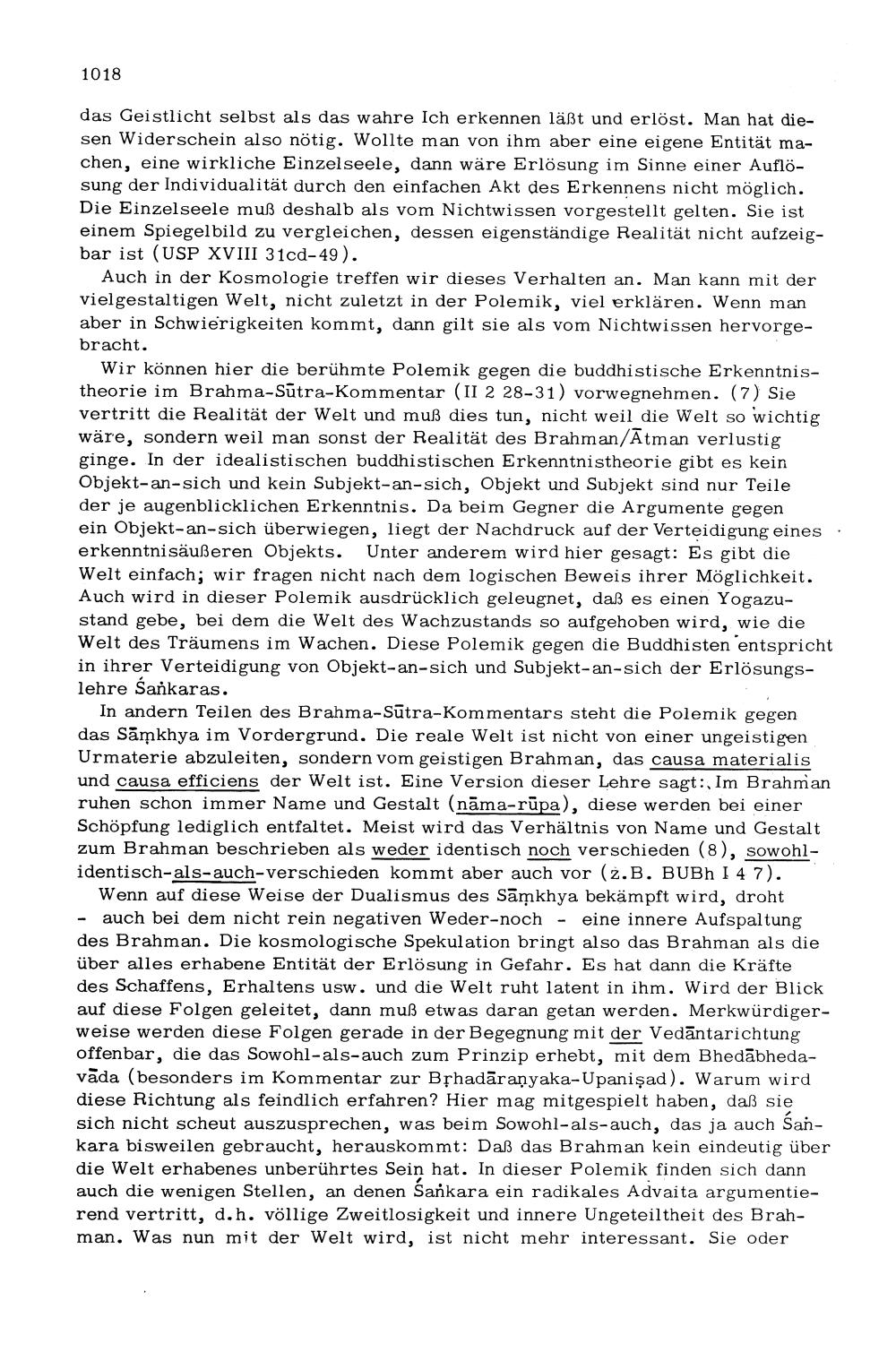Book Title: Sanskaras System Author(s): Tilmann Vetter Publisher: Tilmann Vetter View full book textPage 4
________________ 1018 das Geistlicht selbst als das wahre Ich erkennen läßt und erlöst. Man hat diesen Widerschein also nötig. Wollte man von ihm aber eine eigene Entität machen, eine wirkliche Einzelseele, dann wäre Erlösung im Sinne einer Auflösung der Individualität durch den einfachen Akt des Erkennens nicht möglich. Die Einzelseele muß deshalb als vom Nichtwissen vorgestellt gelten. Sie ist einem Spiegelbild zu vergleichen, dessen eigenständige Realität nicht aufzeigbar ist (USP XVIII 31cd-49). Auch in der Kosmologie treffen wir dieses Verhalten an. Man kann mit der vielgestaltigen Welt, nicht zuletzt in der Polemik, viel erklären. Wenn man aber in Schwierigkeiten kommt, dann gilt sie als vom Nichtwissen hervorgebracht. Wir können hier die berühmte Polemik gegen die buddhistische Erkenntnistheorie im Brahma-Sūtra-Kommentar (II 2 28-31) vorwegnehmen. (7) Sie vertritt die Realität der Welt und muß dies tun, nicht weil die Welt so wichtig wäre, sondern weil man sonst der Realität des Brahman/Atman verlustig ginge. In der idealistischen buddhistischen Erkenntnistheorie gibt es kein Objekt-an-sich und kein Subjekt-an-sich, Objekt und Subjekt sind nur Teile der je augenblicklichen Erkenntnis. Da beim Gegner die Argumente gegen ein Objekt-an-sich überwiegen, liegt der Nachdruck auf der Verteidigung eines · erkenntnisäußeren Objekts. Unter anderem wird hier gesagt: Es gibt die Welt einfach; wir fragen nicht nach dem logischen Beweis ihrer Möglichkeit. Auch wird in dieser Polemik ausdrücklich geleugnet, daß es einen Yogazustand gebe, bei dem die Welt des Wachzustands so aufgehoben wird, wie die Welt des Träumens im Wachen. Diese Polemik gegen die Buddhisten entspricht in ihrer Verteidigung von Objekt-an-sich und Subjekt-an-sich der Erlösungslehre Sankaras. In andern Teilen des Brahma-Sūtra-Kommentars steht die Polemik gegen das Sāmkhya im Vordergrund. Die reale Welt ist nicht von einer ungeistigen Urmaterie abzuleiten, sondern vom geistigen Brahman, das causa materialis und causa efficiens der Welt ist. Eine Version dieser Lehre sagt: Im Brahman ruhen schon immer Name und Gestalt (nāma-rupa), diese werden bei einer Schöpfung lediglich entfaltet. Meist wird das Verhältnis von Name und Gestalt zum Brahman beschrieben als weder identisch noch verschieden (8), sowohlidentisch-als-auch-verschieden kommt aber auch vor (2.B. BUBh I 47). Wenn auf diese Weise der Dualismus des Sāmkhya bekämpft wird, droht - auch bei dem nicht rein negativen Weder-noch - eine innere Aufspaltung des Brahman. Die kosmologische Spekulation bringt also das Brahman als die über alles erhabene Entität der Erlösung in Gefahr. Es hat dann die Kräfte des Schaffens, Erhaltens usw. und die Welt ruht latent in ihm. Wird der Blick auf diese Folgen geleitet, dann muß etwas daran getan werden. Merkwürdigerweise werden diese Folgen gerade in der Begegnung mit der Vedāntarichtung offenbar, die das Sowohl-als-auch zum Prinzip erhebt, mit dem Bhedābhedavada (besonders im Kommentar zur Bșhadāranyaka-Upanişad). Warum wird diese Richtung als feindlich erfahren? Hier mag mitgespielt haben, daß sie sich nicht scheut auszusprechen, was beim Sowohl-als-auch, das ja auch Sankara bisweilen gebraucht, herauskommt: Daß das Brahman kein eindeutig über die Welt erhabenes unberührtes Sein hat. In dieser Polemik finden sich dann auch die wenigen Stellen, an denen Sankara ein radikales Advaita argumentierend vertritt, d.h. völlige Zweitlosigkeit und innere Ungeteiltheit des Brahman. Was nun mit der Welt wird, ist nicht mehr interessant. Sie oderPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8