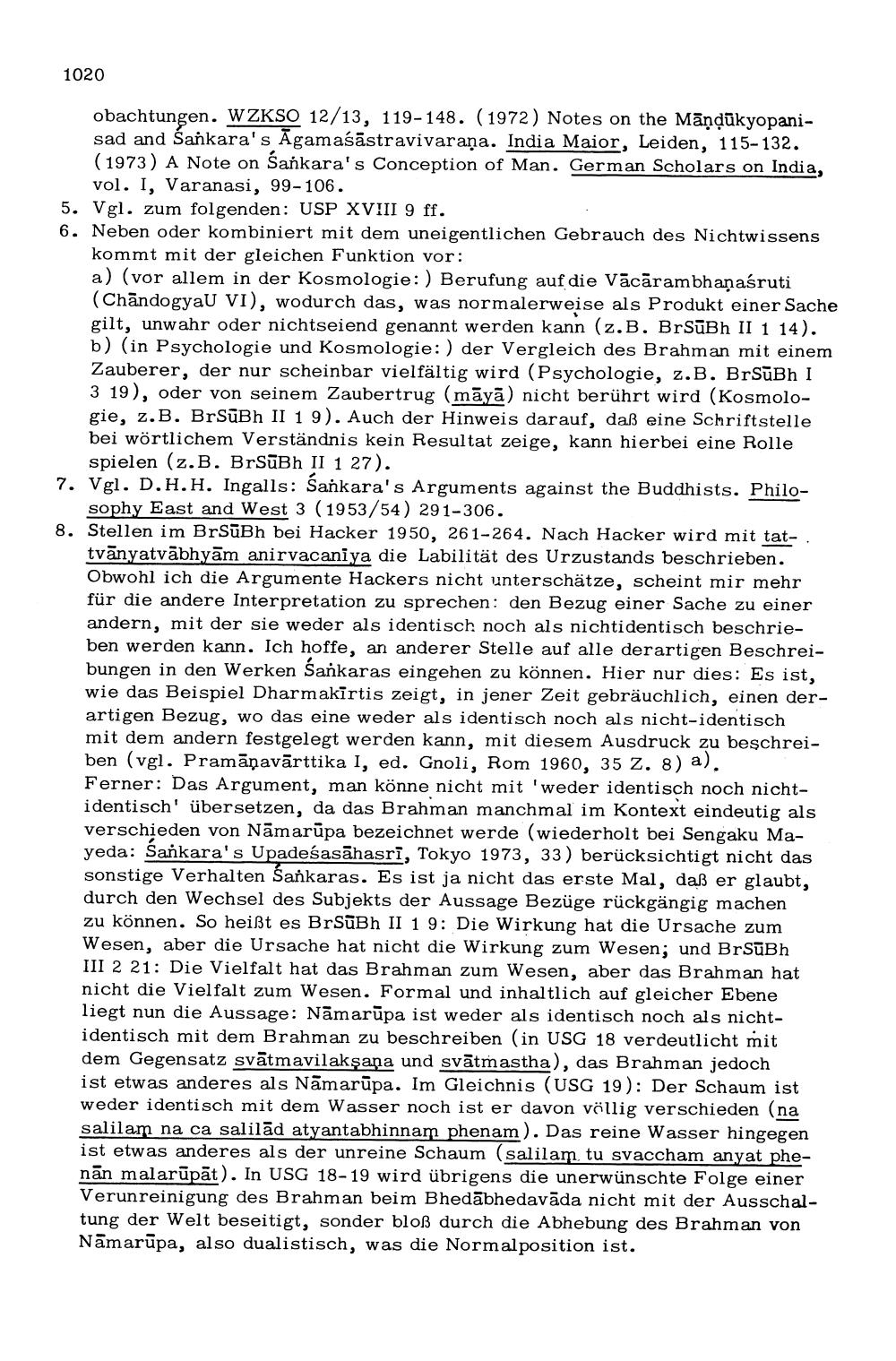Book Title: Sanskaras System Author(s): Tilmann Vetter Publisher: Tilmann Vetter View full book textPage 6
________________ 1020 obachtungen. WZKSO 12/13, 119-148. (1972) Notes on the Māṇḍūkyopanisad and Sankara's Agamaśāstravivarana. India Maior, Leiden, 115-132. (1973) A Note on Sankara's Conception of Man. German Scholars on India, vol. I, Varanasi, 99-106. 5. Vgl. zum folgenden: USP XVIII 9 ff. 6. Neben oder kombiniert mit dem uneigentlichen Gebrauch des Nichtwissens kommt mit der gleichen Funktion vor: a) (vor allem in der Kosmologie:) Berufung auf die Vācārambhaṇaśruti (ChandogyaU VI), wodurch das, was normalerweise als Produkt einer Sache gilt, unwahr oder nichtseiend genannt werden kann (z. B. BrSuBh II 1 14). b) (in Psychologie und Kosmologie:) der Vergleich des Brahman mit einem Zauberer, der nur scheinbar vielfältig wird (Psychologie, z. B. BrSuBh I 3 19), oder von seinem Zaubertrug (māyā) nicht berührt wird (Kosmologie, z.B. BrSuBh II 1 9). Auch der Hinweis darauf, daß eine Schriftstelle bei wörtlichem Verständnis kein Resultat zeige, kann hierbei eine Rolle spielen (z. B. BrSuBh II 1 27). 7. Vgl. D.H.H. Ingalls: Sankara's Arguments against the Buddhists. Philosophy East and West 3 (1953/54) 291-306. 8. Stellen im BrSuBh bei Hacker 1950, 261-264. Nach Hacker wird mit tattvanyatvābhyam anirvacaniya die Labilität des Urzustands beschrieben. Obwohl ich die Argumente Hackers nicht unterschätze, scheint mir mehr für die andere Interpretation zu sprechen: den Bezug einer Sache zu einer andern, mit der sie weder als identisch noch als nichtidentisch beschrieben werden kann. Ich hoffe, an anderer Stelle auf alle derartigen Beschreibungen in den Werken Sankaras eingehen zu können. Hier nur dies: Es ist, wie das Beispiel Dharmakīrtis zeigt, in jener Zeit gebräuchlich, einen derartigen Bezug, wo das eine weder als identisch noch als nicht-identisch mit dem andern festgelegt werden kann, mit diesem Ausdruck zu beschreiben (vgl. Pramāņavārttika I, ed. Gnoli, Rom 1960, 35 Z. 8) a). Ferner: Das Argument, man könne nicht mit 'weder identisch noch nichtidentisch' übersetzen, da das Brahman manchmal im Kontext eindeutig als verschieden von Nāmarupa bezeichnet werde (wiederholt bei Sengaku Mayeda: Sankara's Upadeśasahasrī, Tokyo 1973, 33) berücksichtigt nicht das sonstige Verhalten Sankaras. Es ist ja nicht das erste Mal, daß er glaubt, durch den Wechsel des Subjekts der Aussage Bezüge rückgängig machen zu können. So heißt es BrSuBh II 1 9: Die Wirkung hat die Ursache zum Wesen, aber die Ursache hat nicht die Wirkung zum Wesen; und BrSuBh III 2 21: Die Vielfalt hat das Brahman zum Wesen, aber das Brahman hat nicht die Vielfalt zum Wesen. Formal und inhaltlich auf gleicher Ebene liegt nun die Aussage: Namarupa ist weder als identisch noch als nichtidentisch mit dem Brahman zu beschreiben (in USG 18 verdeutlicht mit dem Gegensatz svātmavilakṣaṇa und svātmastha), das Brahman jedoch ist etwas anderes als Namarupa. Im Gleichnis (USG 19): Der Schaum ist weder identisch mit dem Wasser noch ist er davon völlig verschieden (na salilam na ca salilad atyantabhinnam phenam). Das reine Wasser hingegen ist etwas anderes als der unreine Schaum (salilam tu svaccham anyat phenan malarūpāt). In USG 18-19 wird übrigens die unerwünschte Folge einer Verunreinigung des Brahman beim Bhedabhedavāda nicht mit der Ausschaltung der Welt beseitigt, sonder bloß durch die Abhebung des Brahman von Namarupa, also dualistisch, was die Normalposition ist.Page Navigation
1 ... 4 5 6 7 8