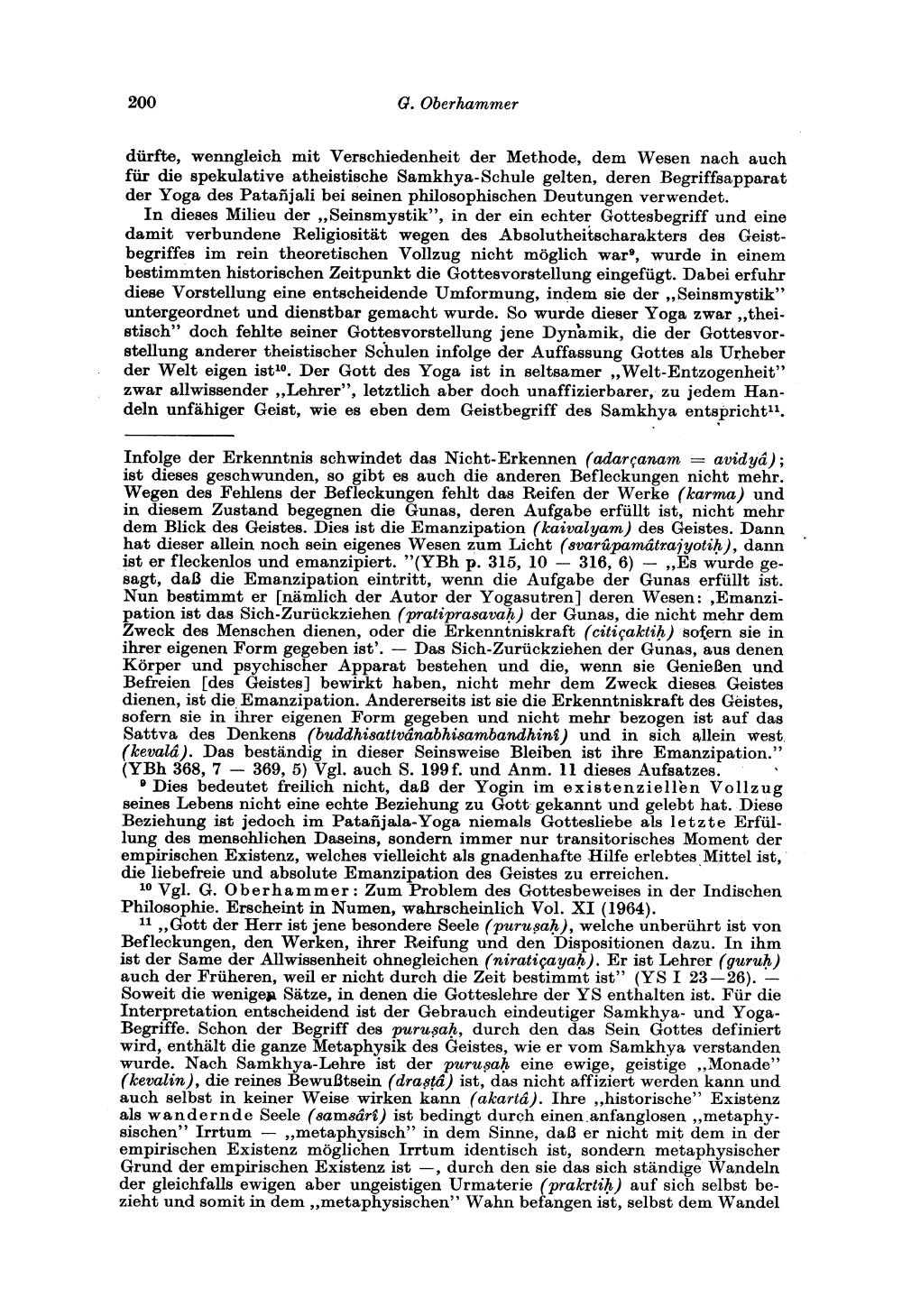Book Title: Gott Urbild Der Emanzipierten Existenz Im Yoga Des Patanjali Author(s): Gerhard Oberhammer Publisher: Gerhard Oberhammer View full book textPage 4
________________ 200 G. Oberhammer dürfte, wenngleich mit Verschiedenheit der Methode, dem Wesen nach auch für die spekulative atheistische Samkhya-Schule gelten, deren Begriffsapparat der Yoga des Patañjali bei seinen philosophischen Deutungen verwendet. In dieses Milieu der Seinsmystik", in der ein echter Gottesbegriff und eine damit verbundene Religiosität wegen des Absolutheitscharakters des Geistbegriffes im rein theoretischen Vollzug nicht möglich war, wurde in einem bestimmten historischen Zeitpunkt die Gottesvorstellung eingefügt. Dabei erfuhr diese Vorstellung eine entscheidende Umformung, indem sie der ,, Seinsmystik" untergeordnet und dienstbar gemacht wurde. So wurde dieser Yoga zwar ,,theistisch" doch fehlte seiner Gottesvorstellung jene Dynamik, die der Gottesvorstellung anderer theistischer Schulen infolge der Auffassung Gottes als Urheber der Welt eigen ist 10. Der Gott des Yoga ist in seltsamer ,,Welt-Entzogenheit" zwar allwissender ,,Lehrer", letztlich aber doch unaffizierbarer, zu jedem Handeln unfähiger Geist, wie es eben dem Geistbegriff des Samkhya entspricht". Infolge der Erkenntnis schwindet das Nicht-Erkennen (adarçanam = avidya); ist dieses geschwunden, so gibt es auch die anderen Befleckungen nicht mehr. Wegen des Fehlens der Befleckungen fehlt das Reifen der Werke (karma) und in diesem Zustand begegnen die Gunas, deren Aufgabe erfüllt ist, nicht mehr dem Blick des Geistes. Dies ist die Emanzipation (kaivalyam) des Geistes. Dann hat dieser allein noch sein eigenes Wesen zum Licht (svarú památrajyotih), dann ist er fleckenlos und emanzipiert. "(YBh p. 315, 10 -- 316, 6) -- ,,Es wurde gesagt, daß die Emanzipation eintritt, wenn die Aufgabe der Gunas erfüllt ist. Nun bestimmt er (nämlich der Autor der Yogasutren] deren Wesen: , Emanzipation ist das Sich-Zurückziehen prati prasavah) der Gunas, die nicht mehr dem Zweck des Menschen dienen, oder die Erkenntniskraft (citiçaktih) sofern sie in ihrer eigenen Form gegeben ist'. -- Das Sich-Zurückziehen der Gunas, aus denen Körper und psychischer Apparat bestehen und die, wenn sie Genießen und Befreien [des Geistes bewirkt haben, nicht mehr dem Zweck dieses Geistes dienen, ist die Emanzipation. Andererseits ist sie die Erkenntniskraft des Geistes, sofern sie in ihrer eigenen Form gegeben und nicht mehr bezogen ist auf das Sattva des Denkens (buddhisattvanabhisambandhini) und in sich allein west, (kevalá). Das beständig in dieser Seinsweise Bleiben ist ihre Emanzipation." (YBh 368, 7 - 369, 5) Vgl. auch S. 199 f. und Anm. 11 dieses Aufsatzes. Dies bedeutet freilich nicht, daß der Yogin im existenziellen Vollzug seines Lebens nicht eine echte Beziehung zu Gott gekannt und gelebt hat. Diese Beziehung ist jedoch im Patañjala-Yoga niemals Gottesliebe als letzte Erfüllung des menschlichen Daseins, sondern immer nur transitorisches Moment der empirischen Existenz, welches vielleicht als gnadenhafte Hilfe erlebtes Mittel ist, die liebefreie und absolute Emanzipation des Geistes zu erreichen. 10 Vgl. G. Oberhammer: Zum Problem des Gottesbeweises in der Indischen Philosophie. Erscheint in Numen, wahrscheinlich Vol. XI (1964). 11 „Gott der Herr ist jene besondere Seele (purusah), welche unberührt ist von Befleckungen, den Werken, ihrer Reifung und den Dispositionen dazu. In ihm ist der Same der Allwissenheit ohnegleichen (niratiçayah). Er ist Lehrer (guruh) auch der Früheren, weil er nicht durch die Zeit bestimmt ist" (YSI 23-26). - Soweit die wenigen Sätze, in denen die Gotteslehre der YS enthalten ist. Für die Interpretation entscheidend ist der Gebrauch eindeutiger Samkhya- und YogaBegriffe. Schon der Begriff des purusah, durch den das Sein Gottes definiert wird, enthält die ganze Metaphysik des Geistes, wie er vom Samkhya verstanden wurde. Nach Samkhya-Lehre ist der purusah eine ewige, geistige Monade" (kevalin), die reines Bewußtsein (drasta) ist, das nicht affiziert werden kann und auch selbst in keiner Weise wirken kann (akarta). Ihre „historische" Existenz als wandernde Seele (samsári) ist bedingt durch einen anfanglosen ,metaphysischen" Irrtum - ,,metaphysisch" in dem Sinne, daß er nicht mit dem in der empirischen Existenz möglichen Irrtum identisch ist, sondern metaphysischer Grund der empirischen Existenz ist –, durch den sie das sich ständige Wandeln der gleichfalls ewigen aber ungeistigen Urmaterie prakrtih) auf sich selbst bezieht und somit in dem ,,metaphysischen Wahn befangen ist, selbst dem WandelPage Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11