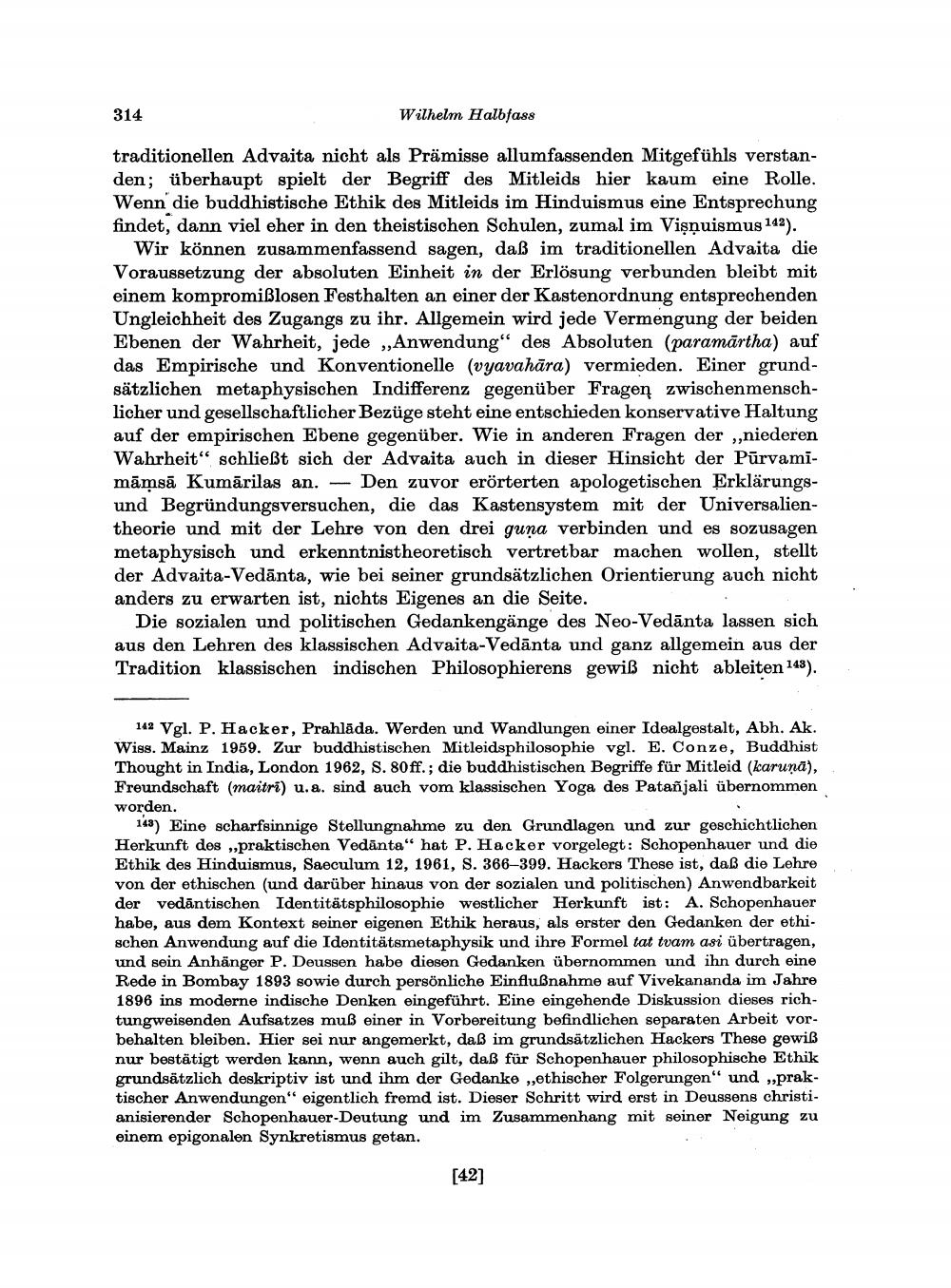________________
314
Wilhelm Halbfass
traditionellen Advaita nicht als Prämisse allumfassenden Mitgefühls verstanden; überhaupt spielt der Begriff des Mitleids hier kaum eine Rolle. Wenn die buddhistische Ethik des Mitleids im Hinduismus eine Entsprechung findet, dann viel eher in den theistischen Schulen, zumal im Vişnuismus 142).
Wir können zusammenfassend sagen, daß im traditionellen Advaita die Voraussetzung der absoluten Einheit in der Erlösung verbunden bleibt mit einem kompromißlosen Festhalten an einer der Kastenordnung entsprechenden Ungleichheit des Zugangs zu ihr. Allgemein wird jede Vermengung der beiden Ebenen der Wahrheit, jede ,,Anwendung" des Absoluten (paramārtha) auf das Empirische und Konventionelle (vyavahāra) vermieden. Einer grundsätzlichen metaphysischen Indifferenz gegenüber Fragen zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Bezüge steht eine entschieden konservative Haltung auf der empirischen Ebene gegenüber. Wie in anderen Fragen der „niederen Wahrheit“ schließt sich der Advaita auch in dieser Hinsicht der Pūrvamimāmsā Kumārilas an. - Den zuvor erörterten apologetischen Erklärungsund Begründungsversuchen, die das Kastensystem mit der Universalientheorie und mit der Lehre von den drei guna verbinden und es sozusagen metaphysisch und erkenntnistheoretisch vertretbar machen wollen, stellt der Advaita-Vedānta, wie bei seiner grundsätzlichen Orientierung auch nicht anders zu erwarten ist, nichts Eigenes an die Seite.
Die sozialen und politischen Gedankengänge des Neo-Vedānta lassen sich aus den Lehren des klassischen Advaita-Vedānta und ganz allgemein aus der Tradition klassischen indischen Philosophierens gewiß nicht ableiten 148).
142 Vgl. P. Hacker, Prahlada. Werden und Wandlungen einer Idealgestalt, Abh. Ak. Wiss. Mainz 1959. Zur buddhistischen Mitleidsphilosophie vgl. E. Conze, Buddhist Thought in India, London 1962, S. 80ff.; die buddhistischen Begriffe für Mitleid (karunā), Freundschaft (maitri) u.a. sind auch vom klassischen Yoga des Patañjali übernommen worden.
148) Eine scharfsinnige Stellungnahme zu den Grundlagen und zur geschichtlichen Herkunft des praktischen Vedānta" hat P. Hacker vorgelegt: Schopenhauer und die Ethik des Hinduismus, Saeculum 12, 1961, S. 366-399. Hackers These ist, daß die Lehre von der ethischen (und darüber hinaus von der sozialen und politischen) Anwendbarkeit der vedāntischen Identitätsphilosophie westlicher Herkunft ist: A. Schopenhauer habe, aus dem Kontext seiner eigenen Ethik heraus, als erster den Gedanken der ethischen Anwendung auf die Identitätsmetaphysik und ihre Formel tat tvam asi übertragen, und sein Anhänger P. Deussen habe diesen Gedanken übernommen und ihn durch eine Rede in Bombay 1893 sowie durch persönliche Einflußnahme auf Vivekananda im Jahre 1896 ins moderne indische Denken eingeführt. Eine eingehende Diskussion dieses richtungweisenden Aufsatzes muß einer in Vorbereitung befindlichen separaten Arbeit vor. behalten bleiben. Hier sei nur angemerkt, daß im grundsätzlichen Hackers These gewiß nur bestätigt werden kann, wenn auch gilt, daß für Schopenhauer philosophische Ethik grundsätzlich deskriptiv ist und ihm der Gedanke ,,ethischer Folgerungen" und „praktischer Anwendungen" eigentlich fremd ist. Dieser Schritt wird erst in Deussens christianisierender Schopenhauer-Deutung und im Zusammenhang mit seiner Neigung zu einem epigonalen Synkretismus getan.
[42]