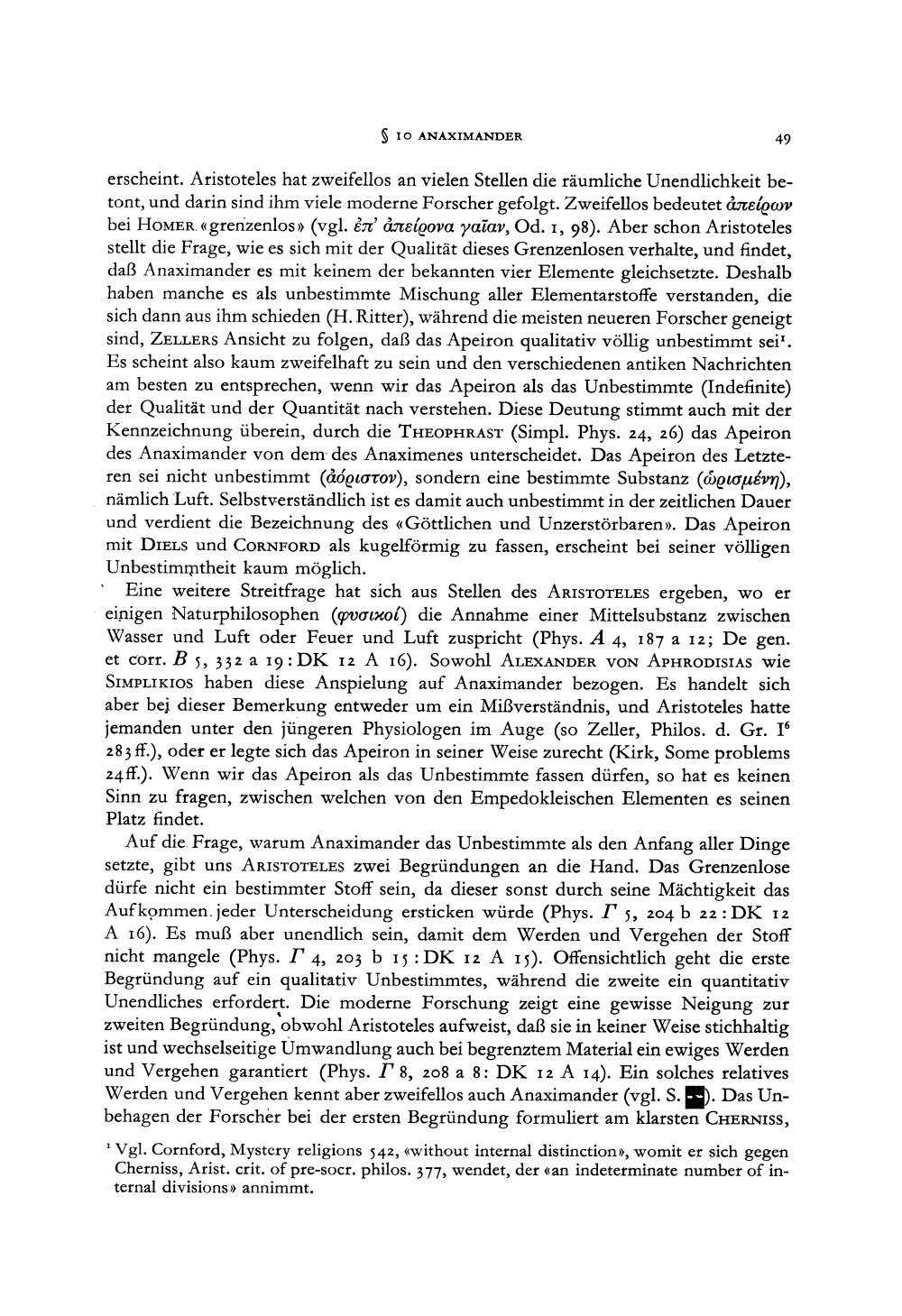Book Title: Vorattische Philosophie Author(s): Thales Von Publisher: Thales Von View full book textPage 9
________________ SIO ANAXIMANDER erscheint. Aristoteles hat zweifellos an vielen Stellen die räumliche Unendlichkeit betont, und darin sind ihm viele moderne Forscher gefolgt. Zweifellos bedeutet årelowv bei HOMER.«grenzenlos » (vgl. Ér' åreloova yatav, Od. 1, 98). Aber schon Aristoteles stellt die Frage, wie es sich mit der Qualität dieses Grenzenlosen verhalte, und findet, daß Anaximander es mit keinem der bekannten vier Elemente gleichsetzte. Deshalb haben manche es als unbestimmte Mischung aller Elementarstoffe verstanden, die sich dann aus ihm schieden (H. Ritter), während die meisten neueren Forscher geneigt sind, ZELLERS Ansicht zu folgen, daß das Apeiron qualitativ völlig unbestimmt sei'. Es scheint also kaum zweifelhaft zu sein und den verschiedenen antiken Nachrichten am besten zu entsprechen, wenn wir das Apeiron als das Unbestimmte (Indefinite) der Qualität und der Quantität nach verstehen. Diese Deutung stimmt auch mit der Kennzeichnung überein, durch die THEOPHRAST (Simpl. Phys. 24, 26) das Apeiron des Anaximander von dem des Anaximenes unterscheidet. Das Apeiron des Letzteren sei nicht unbestimmt (åóQlotov), sondern eine bestimmte Substanz (plouévn), nämlich Luft. Selbstverständlich ist es damit auch unbestimmt in der zeitlichen Dauer und verdient die Bezeichnung des «Göttlichen und Unzerstörbaren». Das Apeiron mit Diels und CORNFord als kugelförmig zu fassen, erscheint bei seiner völligen Unbestimmtheit kaum möglich. Eine weitere Streitfrage hat sich aus Stellen des ARISTOTELES ergeben, wo er einigen Naturphilosophen (voixot) die Annahme einer Mittelsubstanz zwischen Wasser und Luft oder Feuer und Luft zuspricht (Phys. A 4, 187 a 12; De gen. et corr. B 5, 332 a 19: DK 12 A 16). Sowohl ALEXANDER VON APHRODISIAS wie SIMPLIKIOS haben diese Anspielung auf Anaximander bezogen. Es handelt sich aber bei dieser Bemerkung entweder um ein Mißverständnis, und Aristoteles hatte jemanden unter den jüngeren Physiologen im Auge (so Zeller, Philos. d. Gr. I 283 ff.), oder er legte sich das Apeiron in seiner Weise zurecht (Kirk, Some problems 24ff.). Wenn wir das Apeiron als das Unbestimmte fassen dürfen, so hat es keinen Sinn zu fragen, zwischen welchen von den Empedokleischen Elementen es seinen Platz findet. Auf die Frage, warum Anaximander das Unbestimmte als den Anfang aller Dinge setzte, gibt uns ARISTOTELES zwei Begründungen an die Hand. Das Grenzenlose dürfe nicht ein bestimmter Stoff sein, da dieser sonst durch seine Mächtigkeit das Aufkommen. jeder Unterscheidung ersticken würde (Phys. I's, 204 b 22: DK 12 A 16). Es muß aber unendlich sein, damit dem Werden und Vergehen der Stoff nicht mangele (Phys. I' 4, 203 b 15: DK 12 A 15). Offensichtlich geht die erste Begründung auf ein qualitativ Unbestimmtes, während die zweite ein quantitativ Unendliches erfordert. Die moderne Forschung zeigt eine gewisse Neigung zur zweiten Begründung, obwohl Aristoteles aufweist, daß sie in keiner Weise stichhaltig ist und wechselseitige Umwandlung auch bei begrenztem Material ein ewiges Werden und Vergehen garantiert (Phys. I 8, 208 a 8: DK 12 A 14). Ein solches relatives Werden und Vergehen kennt aber zweifellos auch Anaximander (vgl. S. --). Das Unbehagen der Forscher bei der ersten Begründung formuliert am klarsten CHERNISS, Vgl. Cornford, Mystery religions 542, «without internal distinction», womit er sich gegen Cherniss, Arist. crit. of pre-socr. philos. 377, wendet, der an indeterminate number of internal divisions > annimmt.Page Navigation
1 ... 7 8 9 10 11 12