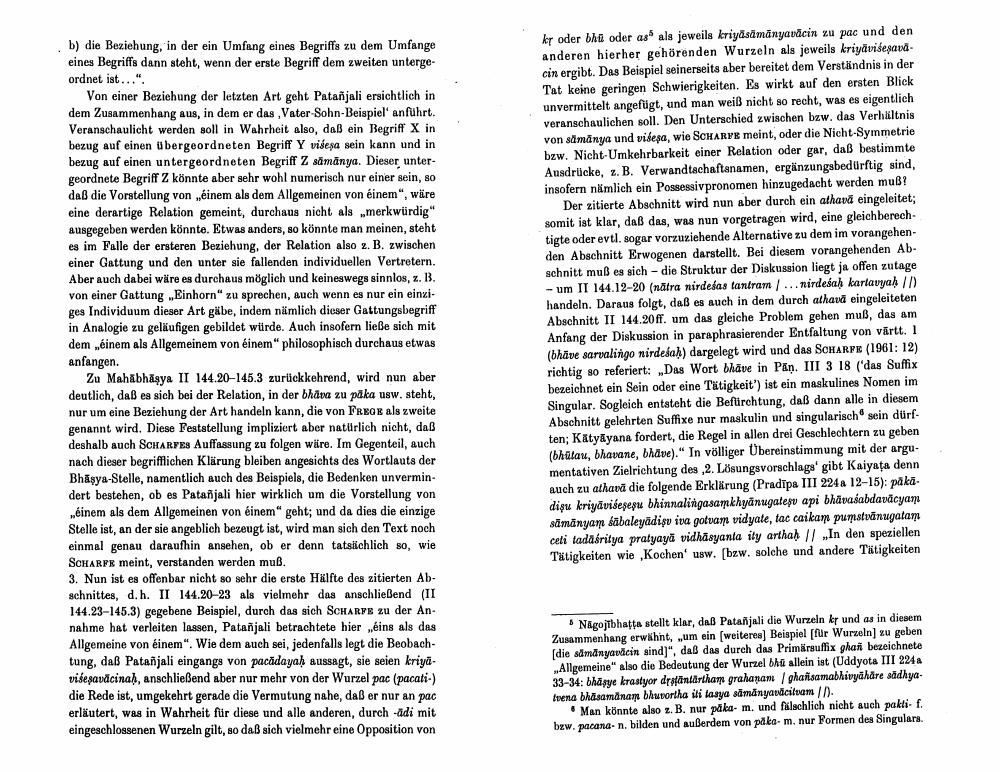Book Title: Archiv Fur Indische Philosophie Author(s): A Wezler Publisher: A Wezler View full book textPage 3
________________ b) die Beziehung, in der ein Umfang eines Begriffs zu dem Umfange eines Begriffs dann steht, wenn der erste Begriff dem zweiten untergeordnet ist...". Von einer Beziehung der letzten Art geht Patañjali ersichtlich in dem Zusammenhang aus, in dem er das,Vater Sohn-Beispiel' anfuhrt. Veranschaulicht werden soll in Wahrheit also, daß ein Begriff X in bezug auf einen Übergeordneten Begriff Y visesa sein kann und in bezug auf einen untergeordneten Begriff z simanya. Dieser untergeordnete Begriff Z könnte aber sehr wohl numerisch nur einer sein, so daß die Vorstellung von einem als dem Allgemeinen von einem", wire eine derartige Relation gemeint, durchaus nicht als merkwürdig" ausgegeben werden könnte. Etwas anders, so könnte man meinen, steht es im Falle der ersteren Beziehung, der Relation also z. B. zwischen einer Gattung und den unter sie fallenden individuellen Vertretern. Aber auch dabei wire es durchaus möglich und keineswegs sinnlos, x. B. von einer Gattung „Einhorn" zu sprechen, auch wenn es nur ein einzi ges Individuum dieser Art gäbe, indem nämlich dieser Gattungsbegriff in Analogie zu geläufigen gebildet wurde. Auch insofern ließe sich mit dem „einem als Allgemeinem von einem" philosophisch durchaus etwas anfangen. Za Mahabhagya II 144.20-145.3 zurückkehrend, wird nun aber deutlich, daß es sich bei der Relation, in der bhara zu paka usw. steht, nur um eine Beziehung der Art handeln kann, die von Frege als zweite genannt wird. Diese Feststellung impliziert aber natürlich nicht, daß deshalb auch SCHARFES Auffassung zu folgen wäre. Im Gegenteil, auch nach dieser begrifflichen Klärung bleiben angesichts des Wortlauts der Bhasya-Stelle, namentlich auch des Beispiels, die Bedenken unvermindert bestehen, ob es Patanjali hier wirklich um die Vorstellung von binem als dem Allgemeinen von einem geht, und da dies die einzige Stelle ist, an der sie angeblich bezeugt ist, wird man sich den Text noch einmal genau daraufhin ansehen, ob er denn tatslichlich so, wie SCHARFE meint, verstanden werden muß. 3. Nun ist es offenbar nicht so sehr die erste Hälfte des zitierten Abschnittes, d. h. II 144.20-23 als vielmehr das anschließend (II 144.23-145.3) gegebene Beispiel, durch das sich SCHARTS zu der An. nahme hat verleiten lassen, Patañjali betrachtete hier wéins als das Allgemeine von einem". Wie dem auch sei, jedenfalls legt die Beobachtung, daß Patanjali eingangs von pacadayah aussagt, sie seien kriyavisegavacinah, anschließend aber nur mehr von der Wurzel pac (pacati-) die Rede ist, umgekehrt gerade die Vermutung nahe, daß er nur an pac erläutert, was in Wahrheit für diese und alle anderen, durch -adi mit eingeschlossenen Wurzeln gilt, so daß sich vielmehr eine Opposition von kr oder bhe oder as als jeweils kriyasamanyavácin zu pac und den anderen hierher gehörenden Wurzeln als jeweils kriyavisesaud cin ergibt. Das Beispiel seinerseits aber bereitet dem Verstlindnis in der Tat keine geringen Schwierigkeiten. Es wirkt auf den ersten Blick unvermittelt angefügt, und man weiß nicht so recht, was es eigentlich veranschaulichen soll. Den Unterschied zwischen bzw. das Verhältnis von sämnya und videsa, wie SCHARYs meint, oder die Nicht-Symmetrie bzw. Nicht-Umkehrbarkeit einer Relation oder gar, daß bestimmte Ausdrucke, z. B. Verwandtschaftanamen, erglinzungsbedürftig sind, insofern nämlich ein Possessivpronomen hinzugedacht werden muß! Der zitierte Abschnitt wird nun aber durch ein athava eingeleitet; somit ist klar, daß das, was nun vorgetragen wird, eine gleich berech tigte oder evtl. sogar vorzuziehende Alternative zu dem im vorangehen den Abschnitt Erwogenen darstellt. Bei diesem vorangehenden Abschnitt muß es sich die Struktur der Diskussion liegt ja offen zutage - um II 144.12-20 (nātra nirdesas tantram / ... nirdesah karlavyah 18) handeln. Daraus folgt, daß es auch in dem durch athana eingeleiteten Abschnitt II 144.20ff. um das gleiche Problem gehen muß, das am Anfang der Diskussion in paraphrasierender Entfaltung von vartt. 1 (bhāve sarvalingo nirdebah) dargelegt wird und das SOHARF (1961: 12) richtig so referiert: ,,Das Wort bhāve in Pan. III 3 18 (das Suffix bezeichnet ein Sein oder eine Tätigkeit') ist ein maskulines Nomen im Singular. Sogleich entsteht die Befürchtung, daß dann alle in diesem Abschnitt gelehrten Suffixe nur maskulin und singularisch sein dürften; Kityāyana fordert, die Regel in allen drei Geschlechtern zu geben (bhütau, bhavane, bhave)." In völliger Übereinstimmung mit der argumentativen Zielrichtung des 2. Lösungsvorschlags' gibt Kaiyata denn auch zu athavd die folgende Erklärung (Pradipa III 224 a 12-15): pakadişu kriyavisesepu bhinnalingasamkhyānugateşv api bhavaiabdavacyam samanyam Sabaleyadişu iva gotuam vidyale, tac caikam pumpstudnugatan ceti tadaéritya pratyayā vidhäsyanla ily arthah // ,In den speziellen Tutigkeiten wie Kochen usw. (bzw. solche und andere Tätigkeiten Nagojtbhatta stellt klar, daß Patañjali die Wurzeln kr und as in diesem Zusammenhang erwähnt, „um ein weiteres] Beispiel [fur Wurzeln) zu geben [die sdmdnyandcin sind)", daß das durch das Primärsuflix ghax bezeichnete ,,Allgemeine" also die Bedeutung der Wurzel bhú allein ist (Uddyota III 224 a 33-34: bhane krastyor drsantartham graharamı / ghaflamabhivalare sadhya trena bhāsamaram bhurortha ili tasya sāmányavācitam D. Man könnte also z. B. nur paka-m. und falschlich nicht auch pakti f. bzw. pacana. n. bilden und außerdem von pika-m. nur Formen des Singulars,Page Navigation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10