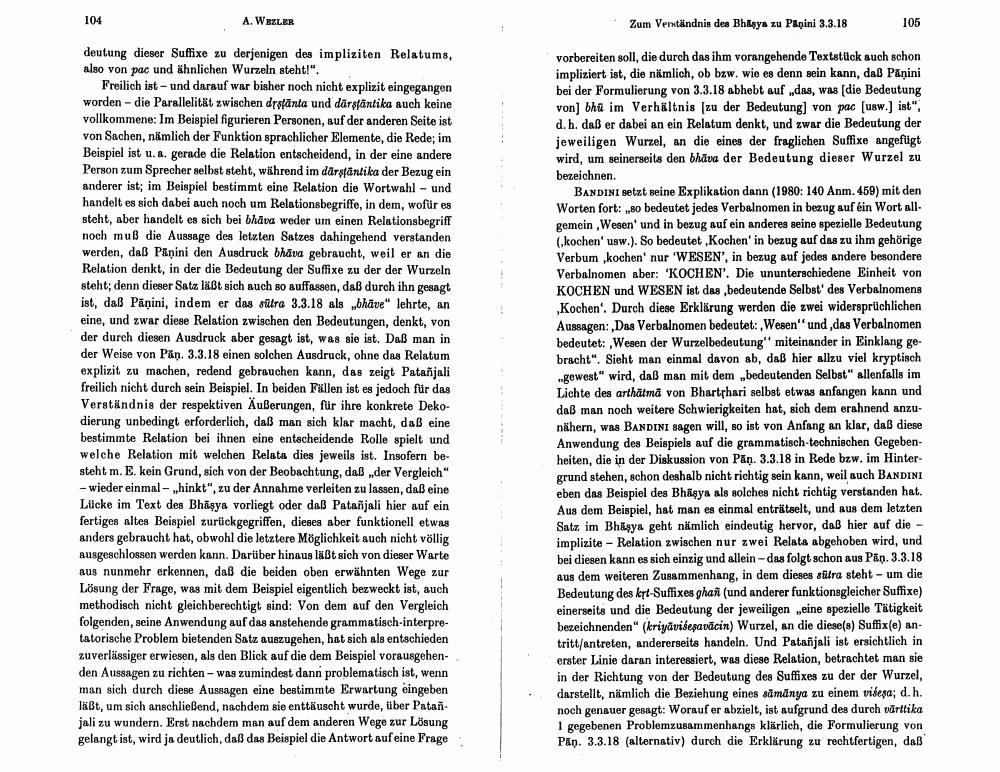Book Title: Archiv Fur Indische Philosophie Author(s): A Wezler Publisher: A Wezler View full book textPage 8
________________ 104 A. WEZLER Zum Verständnis des Bhagya zu Papini 3.3.18 105 deutung dieser Suffixe zu derjenigen des impliziten Relatums, also von pac und ähnlichen Wurzeln steht!". Freilich ist - und darauf war bisher noch nicht explizit eingegangen worden - die Parallelität zwischen drstānta und dārsfântika auch keine vollkommene: Im Beispiel figurieren Personen, auf der anderen Seite ist von Sachen, nämlich der Funktion sprachlicher Elemente, die Rede; im Beispiel ist u. a. gerade die Relation entscheidend, in der eine andere Person zum Sprecher selbst steht, während im darsfantika der Bezug ein anderer ist; im Beispiel bestimmt eine Relation die Wortwahl- und handelt es sich dabei auch noch um Relationsbegriffe, in dem, wofür es steht, aber handelt es sich bei bhava weder um einen Relationsbegriff noch muß die Aussage des letzten Satzes dahingehend verstanden werden, daß Panini den Ausdruck bhāva gebraucht, weil er an die Relation denkt, in der die Bedeutung der Suffixe zu der der Wurzeln steht; denn dieser Satz läßt sich auch so auffassen, daß durch ihn gesagt ist, daß Pāņini, indem er das sutra 3.3.18 als „bhave" lehrte, an eine, und zwar diese Relation zwischen den Bedeutungen, denkt, von der durch diesen Ausdruck aber gesagt ist, was sie ist. Daß man in der Weise von Pån. 3.3.18 einen solchen Ausdruck, ohne das Relatum explizit zu machen, redend gebrauchen kann, das zeigt Patañjali freilich nicht durch sein Beispiel. In beiden Fällen ist es jedoch für das Verständnis der respektiven Außerungen, für ihre konkrete Dekodierung unbedingt erforderlich, daß man sich klar macht, daß eine bestimmte Relation bei ihnen eine entscheidende Rolle spielt und welche Relation mit welchen Relata dies jeweils ist. Insofern be steht m. E. kein Grund, sich von der Beobachtung, daß der Vergleich - wieder einmal - hinkt", zu der Annahme verleiten zu lassen, daß eine Lücke im Text des Bhāşya vorliegt oder daß Patañjali hier auf ein fertiges altes Beispiel zurückgegriffen, dieses aber funktionell etwas anders gebraucht hat, obwohl die letztere Möglichkeit auch nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Darüber hinaus läßt sich von dieser Wart aus nunmehr erkennen, daß die beiden oben erwähnten Wege zur Lösung der Frage, was mit dem Beispiel eigentlich bezweckt ist, auch methodisch nicht gleichberechtigt sind: Von dem auf den Vergleich folgenden, seine Anwendung auf das anstehende grammatisch-interpretatorische Problem bietenden Satz auszugehen, hat sich als entschieden zuverlässiger erwiesen, als den Blick auf die dem Beispiel vorausgehenden Aussagen zu richten - was zumindest dann problematisch ist, wenn man sich durch diese Aussagen eine bestimmte Erwartung eingeben laßt, um sich anschließend, nachdem sie enttäuscht wurde, über Patanjali zu wundern. Erst nachdem man auf dem anderen Wege zur Lösung gelangt ist, wird ja deutlich, daß das Beispiel die Antwort auf eine Frage vorbereiten soll, die durch das ihm vorangehende Textstück auch schon impliziert ist, die nämlich, ob bzw. wie es denn sein kann, daß Panini bei der Formulierung von 3.3.18 abhebt auf das, was (die Bedeutung von) bha im Verhältnis [zu der Bedeutung) von pac (usw.) ist", d. h. daß er dabei an ein Relatum denkt, und zwar die Bedeutung der jeweiligen Wurzel, an die eines der fraglichen Suffixe angefügt wird, um seinerseits den bhāva der Bedeutung dieser Wurzel zu bezeichnen. BANDINI setzt seine Explikation dann (1980: 140 Anm. 459) mit den Worten fort: ,,80 bedeutet jedes Verbalnomen in bezug auf ein Wort all. gemein Wesen und in bezug auf ein anderes seine spezielle Bedeutung (.kochen' usw.). So bedeutet,Kochen' in bezug auf das zu ihm gehörige Verbum ,kochen nur 'WESEN', in bezug auf jedes andere besondere Verbalnomen aber: 'KOCHEN'. Die ununterschiedene Einheit von KOCHEN und WESEN ist das bedeutende Selbst' des Verbalnomens Kochen. Durch diese Erklärung werden die zwei widersprüchlichen Aussagen: „Das Verbalnomen bedeutet: Wesen' und das Verbalnomen bedeutet: Wesen der Wurzelbedeutung'' miteinander in Einklang gebracht". Sieht man einmal davon ab, daß hier allzu viel kryptisch ..gewest" wird, daß man mit dem ,,bedeutenden Selbst" allenfalls im Lichte des arthätma von Bharthari selbst etwas anfangen kann und daß man noch weitere Schwierigkeiten hat, sich dem erahnend anzu. nähern, was BANDINI sagen will, so ist von Anfang an klar, daß diese Anwendung des Beispiels auf die grammatisch-technischen Gegebenheiten, die in der Diskussion von Pan. 3.3.18 in Rede bzw. im Hintergrund stehen, schon deshalb nicht richtig sein kann, weil auch BANDINI eben das Beispiel des Bhagya als solches nicht richtig verstanden hat. Aus dem Beispiel, hat man es einmal entritselt, und aus dem letzten Sata im Bhagya geht nämlich eindeutig hervor, daß hier auf die - implizite - Relation zwischen nur zwei Relats abgehoben wird, und bei diesen kann es sich einzig und allein - das folgt schon aus Pan. 3.3.18 aus dem weiteren Zusammenhang, in dem dieses sutra steht - um die Bedeutung des kert-Suffixes ghan (und anderer funktionsgleicher Suffixe) einerseits und die Bedeutung der jeweiligen eine spezielle Tätigkeit bezeichnenden" (kriyavićeşavācin) Wurzel, an die diese(s) Suffix(e) antritt/antreten, andererseits handeln. Und Patañjali ist ersichtlich in erster Linie daran interessiert, was diese Relation, betrachtet man sie in der Richtung von der Bedeutung des Suffixes zu der der Wurzel, darstellt, niimlich die Beziehung eines admdnya zu einem visesa; d. h. noch genauer gesagt: Worauf er abzielt, ist aufgrund des durch vürttika 1 gegebenen Problemzusammenhanga klirlich, die Formulierung von Pan. 3.3.18 (alternativ) durch die Erklärung zu rechtfertigen, daßPage Navigation
1 ... 6 7 8 9 10