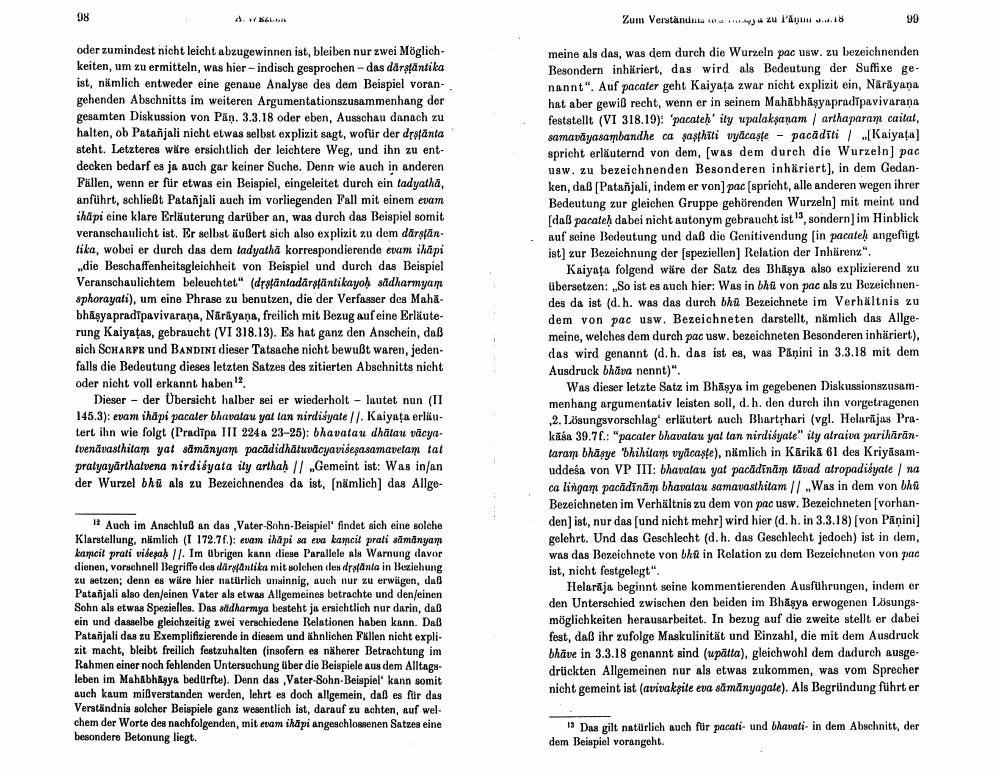________________
98
4.
oder zumindest nicht leicht abzugewinnen ist, bleiben nur zwei Möglichkeiten, um zu ermitteln, was hier-indisch gesprochen - das därṣṭāntika ist, nämlich entweder eine genaue Analyse des dem Beispiel vorangehenden Abschnitts im weiteren Argumentationszusammenhang der gesamten Diskussion von Pan. 3.3.18 oder eben, Ausschau danach zu halten, ob Patanjali nicht etwas selbst explizit sagt, wofür der drstänta steht. Letzteres wäre ersichtlich der leichtere Weg, und ihn zu entdecken bedarf es ja auch gar keiner Suche. Denn wie auch in anderen Fällen, wenn er für etwas ein Beispiel, eingeleitet durch ein tadyatha, anführt, schließt Patanjali auch im vorliegenden Fall mit einem evam ihapi eine klare Erläuterung darüber an, was durch das Beispiel somit veranschaulicht ist. Er selbst äußert sich also explizit zu dem därstän tika, wobei er durch das dem tadyatha korrespondierende evam ihapi „die Beschaffenheitsgleichheit von Beispiel und durch das Beispiel Veranschaulichtem beleuchtet" (drsfäntadärstäntikayoḥ sadharmyam sphorayati), um eine Phrase zu benutzen, die der Verfasser des Mahābhāṣyapradīpavivaraṇa, Nārāyaṇa, freilich mit Bezug auf eine Erläuterung Kaiyațas, gebraucht (VI 318.13). Es hat ganz den Anschein, daß sich SCHARFE und BANDINI dieser Tatsache nicht bewußt waren, jedenfalls die Bedeutung dieses letzten Satzes des zitierten Abschnitts nicht oder nicht voll erkannt haben 12.
Dieser der Übersicht halber sei er wiederholt - lautet nun (II 145.3): evam ihāpi pacater bhavatau yat tan nirdisyate //. Kaiyața erläutert ihn wie folgt (Pradipa III 224 a 23-25): bhavatau dhatau vācyaIvenävasthitam yat samanyam pacādidhātuvācyaviseṣasamavetam tat pratyayarthalvena nirdiśyata ity arthaḥ || Gemeint ist: Was in/an der Wurzel bhi als zu Bezeichnendes da ist, [nämlich] das Allge
12 Auch im Anschluß an das Vater-Sohn-Beispiel' findet sich eine solche Klarstellung, nämlich (I 172.7f.): evam ihapi sa eva kamcil prati sāmānyam kamcit prati višesaḥ //. Im übrigen kann diese Parallele als Warnung davor dienen, vorschnell Begriffe des därgläntika mit solchen des drstanta in Beziehung zu setzen; denn es wäre hier natürlich unsinnig, auch nur zu erwügen, daß Patanjali also den/einen Vater als etwas Allgemeines betrachte und den/einen Sohn als etwas Spezielles. Das sädharmya besteht ja ersichtlich nur darin, daß ein und dasselbe gleichzeitig zwei verschiedene Relationen haben kann. Daß Patanjali das zu Exemplifizierende in diesem und ähnlichen Fällen nicht explizit macht, bleibt freilich festzuhalten (insofern es näherer Betrachtung im Rahmen einer noch fehlenden Untersuchung über die Beispiele aus dem Alltagsleben im Mahābhāṣya bedürfte). Denn das Vater-Sohn-Beispiel kann somit auch kaum mißverstanden werden, lehrt es doch allgemein, daß es für das Verständnis solcher Beispiele ganz wesentlich ist, darauf zu achten, auf welchem der Worte des nachfolgenden, mit evam ihāpi angeschlossenen Satzes eine besondere Betonung liegt.
Zum Verständnis zu Păun..
99
meine als das, was dem durch die Wurzeln pac usw. zu bezeichnenden Besondern inhäriert, das wird als Bedeutung der Suffixe genannt". Auf pacater geht Kaiyața zwar nicht explizit ein, Nārāyaṇa hat aber gewiß recht, wenn er in seinem Mahābhāṣyapradīpavivarana feststellt (VI 318.19): 'pacateḥ' ity upalakṣaṇam | arthaparam caitat, samavayasambandhe ca sasthiti vyacaste pacādīti | Kaiyata] spricht erläuternd von dem, [was dem durch die Wurzeln] pac usw. zu bezeichnenden Besonderen inhäriert], in dem Gedanken, daß [Patanjali, indem er von] pac [spricht, alle anderen wegen ihrer Bedeutung zur gleichen Gruppe gehörenden Wurzeln] mit meint und [daß pacateḥ dabei nicht autonym gebraucht ist 13, sondern] im Hinblick auf seine Bedeutung und daß die Genitivendung [in pacateḥ angefügt ist] zur Bezeichnung der [speziellen] Relation der Inhärenz".
Kaiyata folgend wäre der Satz des Bhasya also explizierend zu übersetzen: So ist es auch hier: Was in bhu von pac als zu Bezeichnendes da ist (d. h. was das durch bhů Bezeichnete im Verhältnis zu dem von pac usw. Bezeichneten darstellt, nämlich das Allgemeine, welches dem durch pac usw. bezeichneten Besonderen inhäriert), das wird genannt (d. h. das ist es, was Panini in 3.3.18 mit dem Ausdruck bhava nennt)".
Was dieser letzte Satz im Bhasya im gegebenen Diskussionszusammenhang argumentativ leisten soll, d. h. den durch ihn vorgetragenen 2. Lösungsvorschlag' erläutert auch Bhartṛhari (vgl. Helarājas Prakasa 39.7f.: "pacater bhavatau yal tan nirdisyale" ily alraiva parihārāntaram bhāṣye 'bhihitam vyäcaste), nämlich in Karika 61 des Kriyasamuddeśa von VP III: bhavatau yat pacādīnām tavad atropadisyale | na ca lingam pacädīnām bhavatau samavasthitam // Was in dem von bhu Bezeichneten im Verhältnis zu dem von pac usw. Bezeichneten [vorhanden] ist, nur das [und nicht mehr] wird hier (d. h. in 3.3.18) [von Panini] gelehrt. Und das Geschlecht (d. h. das Geschlecht jedoch) ist in dem, was das Bezeichnete von bha in Relation zu dem Bezeichneten von pac ist, nicht festgelegt".
Helaraja beginnt seine kommentierenden Ausführungen, indem er den Unterschied zwischen den beiden im Bhasya erwogenen Lösungsmöglichkeiten herausarbeitet. In bezug auf die zweite stellt er dabei fest, daß ihr zufolge Maskulinität und Einzahl, die mit dem Ausdruck bhave in 3.3.18 genannt sind (upatta), gleichwohl dem dadurch ausgedrückten Allgemeinen nur als etwas zukommen, was vom Sprecher nicht gemeint ist (avivakṣite eva sāmānyagate). Als Begründung führt er
13 Das gilt natürlich auch für pacati- und bhavati- in dem Abschnitt, der dem Beispiel vorangeht.