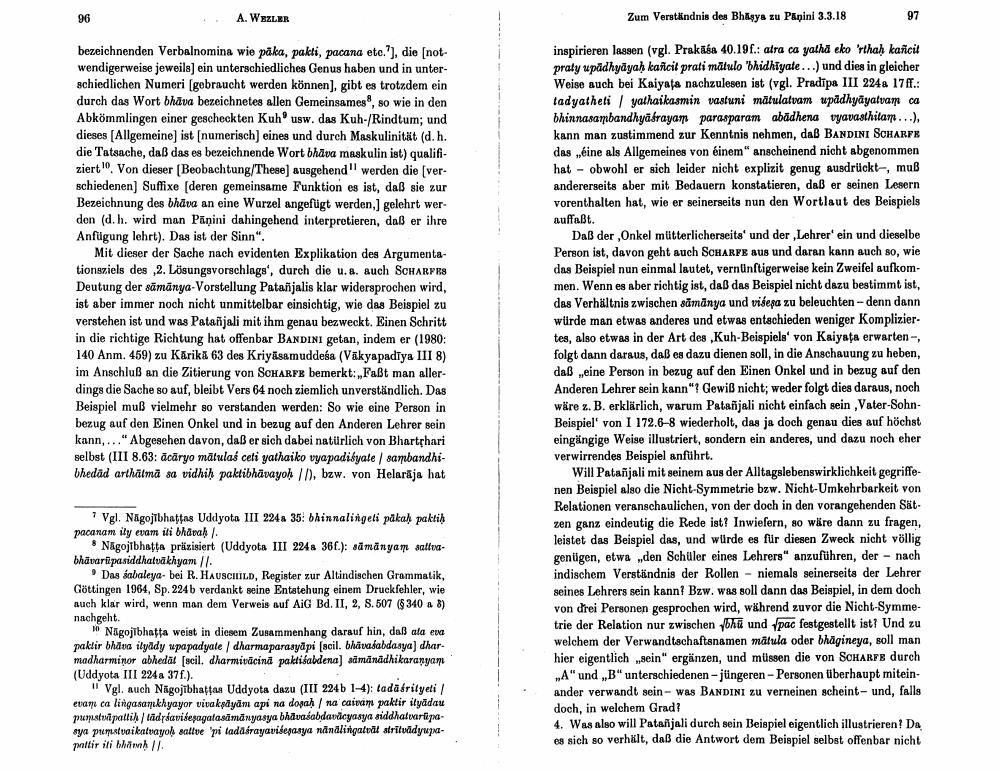________________
A. WEZLER
bezeichnenden Verbalnomina wie paka, pakti, pacana etc."], die [notwendigerweise jeweils] ein unterschiedliches Genus haben und in unterschiedlichen Numeri [gebraucht werden können], gibt es trotzdem ein durch das Wort bhava bezeichnetes allen Gemeinsames, so wie in den Abkömmlingen einer gescheckten Kuh usw. das Kuh-/Rindtum; und dieses [Allgemeine] ist [numerisch] eines und durch Maskulinität (d.h. die Tatsache, daß das es bezeichnende Wort bhava maskulin ist) qualifiziert 10. Von dieser [Beobachtung/These] ausgehend werden die [verschiedenen] Suffixe [deren gemeinsame Funktion es ist, daß sie zur Bezeichnung des bhāva an eine Wurzel angefügt werden,] gelehrt wer den (d. h. wird man Panini dahingehend interpretieren, daß er ihre Anfügung lehrt). Das ist der Sinn".
Mit dieser der Sache nach evidenten Explikation des Argumentationsziels des 2. Lösungsvorschlags', durch die u. a. auch SCHARFES Deutung der samanya-Vorstellung Patanjalis klar widersprochen wird, ist aber immer noch nicht unmittelbar einsichtig, wie das Beispiel zu verstehen ist und was Patanjali mit ihm genau bezweckt. Einen Schritt in die richtige Richtung hat offenbar BANDINI getan, indem er (1980: 140 Anm. 459) zu Kärikä 63 des Kriyasamuddeśa (Vakyapadiya III 8) im Anschluß an die Zitierung von SCHARFE bemerkt:,,Faßt man allerdings die Sache so auf, bleibt Vers 64 noch ziemlich unverständlich. Das Beispiel muß vielmehr so verstanden werden: So wie eine Person in bezug auf den Einen Onkel und in bezug auf den Anderen Lehrer sein kann,..." Abgesehen davon, daß er sich dabei natürlich von Bhartchari selbst (III 8.63: äcäryo matulas ceti yathaiko vyapadiéyate / sambandhibhedad arthātmā sa vidhiḥ paktibhavayoḥ /), bzw. von Helaraja hat
96
* Vgl. Nāgojibhaṭṭas Uddyota III 224a 35: bhinnalingeli pakaḥ paktiḥ pacanam ily evam ili bhavaḥ .
* Nāgojībhaṭṭa präzisiert (Uddyota III 224a 36f.): samanyam sattvabhavar@pasiddhatvākhyam ||.
Das sabaleya- bei R. HAUSCHILD, Register zur Altindischen Grammatik, Göttingen 1964, Sp. 224b verdankt seine Entstehung einem Druckfehler, wie auch klar wird, wenn man dem Verweis auf AiG Bd. II, 2, S. 507 ($340 a 8) nachgeht.
Nāgojībhatta weist in diesem Zusammenhang darauf hin, daß ala eva paklir bhava ilyady upapadyate | dharmaparasyāpi [scil. bhavasabdasya] dharmadharminor abhedat [scil. dharmivacina paktiśabdena] sāmānādhikaranyam (Uddyota III 224a 37f.).
Vgl. auch Nägojibhattas Uddyota dazu (III 224b 1-4): tadaérityeti / evam ca lingasamkhyayor vivakṣāyām api na dosaḥ / na caivam paktir ityadau pumstvapattiḥ tädrśavidezagalasāmanyasya bhavasabdavacyasya siddhatvartipasya pumstvaikatvayoḥ saltve 'pi tadaárayaviseṣasya nānālingatväl stritvädyupapattir iti bhavaḥ 1.
Zum Verständnis des Bhasya zu Panini 3.3.18
inspirieren lassen (vgl. Prakasa 40.19f.: atra ca yatha eko 'rthaḥ kañcit praty upadhyayaḥ kañcit prati matulo 'bhidhiyate...) und dies in gleicher Weise auch bei Kaiyața nachzulesen ist (vgl. Pradipa III 224a 17ff.: tadyatheliyathaikasmin vastuni matulatvam upadhyāyatvam ca bhinnasambandhyasrayam parasparam abadhena vyavasthitam...), kann man zustimmend zur Kenntnis nehmen, daß BANDINI SCHARFE das „éine als Allgemeines von éinem" anscheinend nicht abgenommen hat obwohl er sich leider nicht explizit genug ausdrückt, muß andererseits aber mit Bedauern konstatieren, daß er seinen Lesern vorenthalten hat, wie er seinerseits nun den Wortlaut des Beispiels auffaßt.
97
Daß der,Onkel mütterlicherseits' und der,Lehrer' ein und dieselbe Person ist, davon geht auch SCHARFE aus und daran kann auch so, wie das Beispiel nun einmal lautet, vernünftigerweise kein Zweifel aufkommen. Wenn es aber richtig ist, daß das Beispiel nicht dazu bestimmt ist, das Verhältnis zwischen sämanya und viseşa zu beleuchten - denn dann würde man etwas anderes und etwas entschieden weniger Kompliziertes, also etwas in der Art des Kuh-Beispiels' von Kaiyața erwarten-, folgt dann daraus, daß es dazu dienen soll, in die Anschauung zu heben, daß eine Person in bezug auf den Einen Onkel und in bezug auf den Anderen Lehrer sein kann"? Gewiß nicht; weder folgt dies daraus, noch wäre z. B. erklärlich, warum Patañjali nicht einfach sein, Vater-SohnBeispiel von I 172.6-8 wiederholt, das ja doch genau dies auf höchst eingängige Weise illustriert, sondern ein anderes, und dazu noch eher verwirrendes Beispiel anführt.
Will Patanjali mit seinem aus der Alltagslebenswirklichkeit gegriffenen Beispiel also die Nicht-Symmetrie bzw. Nicht-Umkehrbarkeit von Relationen veranschaulichen, von der doch in den vorangehenden Sätzen ganz eindeutig die Rede ist? Inwiefern, so wäre dann zu fragen, leistet das Beispiel das, und würde es für diesen Zweck nicht völlig genügen, etwa den Schüler eines Lehrers" anzuführen, der nach indischem Verständnis der Rollen niemals seinerseits der Lehrer seines Lehrers sein kann? Bzw. was soll dann das Beispiel, in dem doch von drei Personen gesprochen wird, während zuvor die Nicht-Symmetrie der Relation nur zwischen bhi und pac festgestellt ist? Und zu welchem der Verwandtschaftsnamen matula oder bhagineya, soll man hier eigentlich sein" ergänzen, und müssen die von SCHARFE durch "A" und „B" unterschiedenen - jüngeren - Personen überhaupt miteinander verwandt sein- was BANDINI zu verneinen scheint- und, falls doch, in welchem Grad?
4. Was also will Patanjali durch sein Beispiel eigentlich illustrieren? Da es sich so verhält, daß die Antwort dem Beispiel selbst offenbar nicht