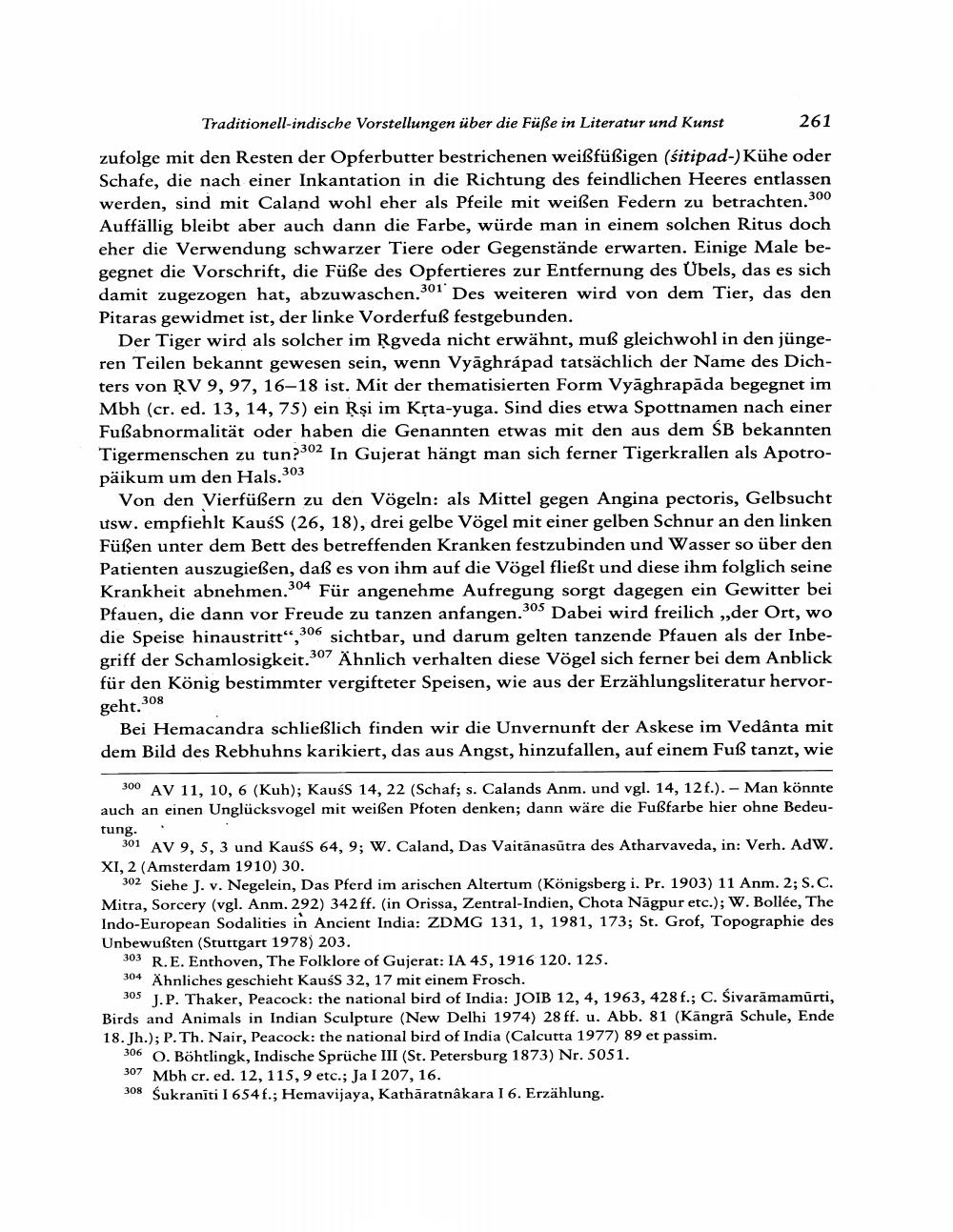________________
Traditionell-indische Vorstellungen über die Füße in Literatur und Kunst
261
300
zufolge mit den Resten der Opferbutter bestrichenen weißfüßigen (śitipad-) Kühe oder Schafe, die nach einer Inkantation in die Richtung des feindlichen Heeres entlassen werden, sind mit Caland wohl eher als Pfeile mit weißen Federn zu betrachten.30 Auffällig bleibt aber auch dann die Farbe, würde man in einem solchen Ritus doch eher die Verwendung schwarzer Tiere oder Gegenstände erwarten. Einige Male begegnet die Vorschrift, die Füße des Opfertieres zur Entfernung des Übels, das es sich damit zugezogen hat, abzuwaschen.301 Des weiteren wird von dem Tier, das den Pitaras gewidmet ist, der linke Vorderfuß festgebunden.
Der Tiger wird als solcher im Rgveda nicht erwähnt, muß gleichwohl in den jüngeren Teilen bekannt gewesen sein, wenn Vyaghrápad tatsächlich der Name des Dichters von RV 9, 97, 16-18 ist. Mit der thematisierten Form Vyaghrapada begegnet im Mbh (cr. ed. 13, 14, 75) ein Rşi im Krta-yuga. Sind dies etwa Spottnamen nach einer Fußabnormalität oder haben die Genannten etwas mit den aus dem SB bekannten Tigermenschen zu tun?302 In Gujerat hängt man sich ferner Tigerkrallen als Apotropäikum um den Hals.303
Von den Vierfüßern zu den Vögeln: als Mittel gegen Angina pectoris, Gelbsucht usw. empfiehlt KauśS (26, 18), drei gelbe Vögel mit einer gelben Schnur an den linken Füßen unter dem Bett des betreffenden Kranken festzubinden und Wasser so über den Patienten auszugießen, daß es von ihm auf die Vögel fließt und diese ihm folglich seine Krankheit abnehmen.304 Für angenehme Aufregung sorgt dagegen ein Gewitter bei Pfauen, die dann vor Freude zu tanzen anfangen.305 Dabei wird freilich,,der Ort, wo die Speise hinaustritt", 306 sichtbar, und darum gelten tanzende Pfauen als der Inbegriff der Schamlosigkeit.307 Ähnlich verhalten diese Vögel sich ferner bei dem Anblick für den König bestimmter vergifteter Speisen, wie aus der Erzählungsliteratur hervorgeht.
308
Bei Hemacandra schließlich finden wir die Unvernunft der Askese im Vedanta mit dem Bild des Rebhuhns karikiert, das aus Angst, hinzufallen, auf einem Fuß tanzt, wie
300 AV 11, 10, 6 (Kuh); KauśS 14, 22 (Schaf; s. Calands Anm. und vgl. 14, 12f.). - Man könnte auch an einen Unglücksvogel mit weißen Pfoten denken; dann wäre die Fußfarbe hier ohne Bedeu
tung.
301 AV 9, 5, 3 und KausS 64, 9; W. Caland, Das Vaitānasūtra des Atharvaveda, in: Verh. AdW. XI, 2 (Amsterdam 1910) 30.
302 Siehe J. v. Negelein, Das Pferd im arischen Altertum (Königsberg i. Pr. 1903) 11 Anm. 2; S. C. Mitra, Sorcery (vgl. Anm. 292) 342 ff. (in Orissa, Zentral-Indien, Chota Nagpur etc.); W. Bollée, The Indo-European Sodalities in Ancient India: ZDMG 131, 1, 1981, 173; St. Grof, Topographie des Unbewußten (Stuttgart 1978) 203.
303 R. E. Enthoven, The Folklore of Gujerat: IA 45, 1916 120. 125.
304 Ähnliches geschieht KauśS 32, 17 mit einem Frosch.
305 J.P. Thaker, Peacock: the national bird of India: JOIB 12, 4, 1963, 428 f.; C. Śivaramamurti, Birds and Animals in Indian Sculpture (New Delhi 1974) 28 ff. u. Abb. 81 (Kangra Schule, Ende 18. Jh.); P. Th. Nair, Peacock: the national bird of India (Calcutta 1977) 89 et passim.
306 O. Böhtlingk, Indische Sprüche III (St. Petersburg 1873) Nr. 5051.
307 Mbh cr. ed. 12, 115, 9 etc.; Ja I 207, 16.
308 Sukranīti 1654f.; Hemavijaya, Kathāratnâkara I 6. Erzählung.