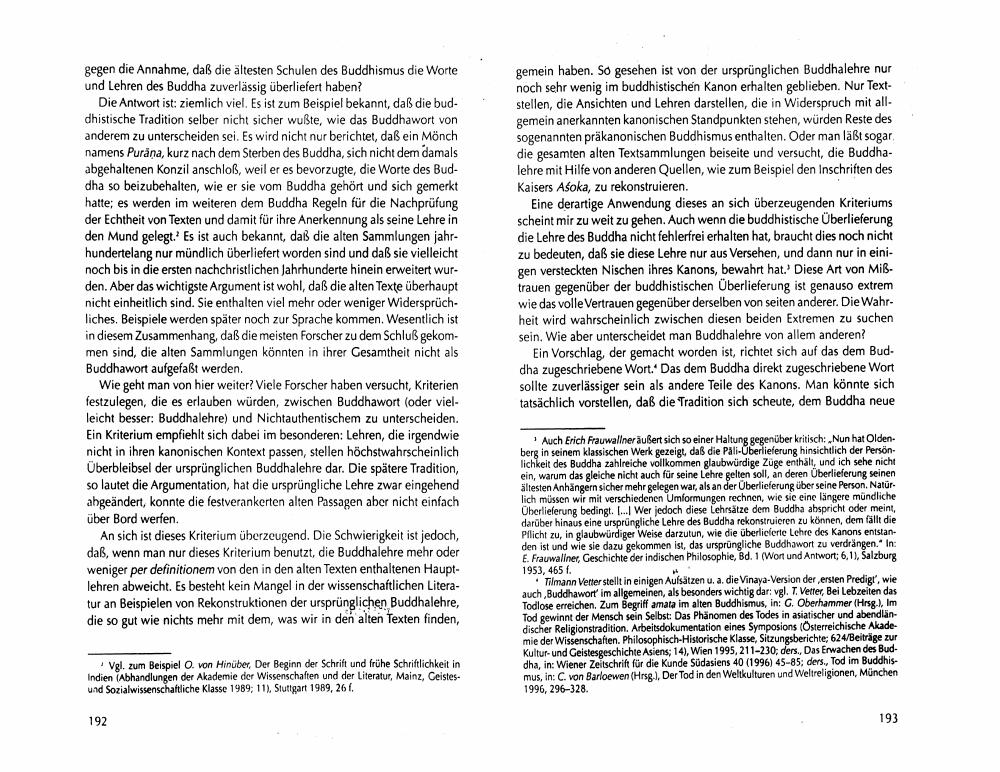________________
gegen die Annahme, daß die ältesten Schulen des Buddhismus die Worte und Lehren des Buddha zuverlässig überliefert haben?
Die Antwort ist: ziemlich viel. Es ist zum Beispiel bekannt, daß die buddhistische Tradition selber nicht sicher wußte, wie das Buddhawort von anderem zu unterscheiden sei. Es wird nicht nur berichtet, daß ein Mönch namens Purana, kurz nach dem Sterben des Buddha, sich nicht dem damals abgehaltenen Konzil anschloß, weil er es bevorzugte, die Worte des Buddha so beizubehalten, wie er sie vom Buddha gehört und sich gemerkt hatte; es werden im weiteren dem Buddha Regeln für die Nachprüfung der Echtheit von Texten und damit für ihre Anerkennung als seine Lehre in den Mund gelegt. Es ist auch bekannt, daß die alten Sammlungen jahrhundertelang nur mündlich überliefert worden sind und daß sie vielleicht noch bis in die ersten nachchristlichen Jahrhunderte hinein erweitert wurden. Aber das wichtigste Argument ist wohl, daß die alten Texte überhaupt nicht einheitlich sind. Sie enthalten viel mehr oder weniger Widersprüchliches. Beispiele werden später noch zur Sprache kommen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, daß die meisten Forscher zu dem Schluß gekommen sind, die alten Sammlungen könnten in ihrer Gesamtheit nicht als Buddhawort aufgefaßt werden.
Wie geht man von hier weiter? Viele Forscher haben versucht, Kriterien festzulegen, die es erlauben würden, zwischen Buddhawort (oder vielleicht besser: Buddhalehre) und Nichtauthentischem zu unterscheiden. Ein Kriterium empfiehlt sich dabei im besonderen: Lehren, die irgendwie nicht in ihren kanonischen Kontext passen, stellen höchstwahrscheinlich Überbleibsel der ursprünglichen Buddhalehre dar. Die spätere Tradition, so lautet die Argumentation, hat die ursprüngliche Lehre zwar eingehend abgeändert, konnte die festverankerten alten Passagen aber nicht einfach über Bord werfen.
An sich ist dieses Kriterium überzeugend. Die Schwierigkeit ist jedoch, daß, wenn man nur dieses Kriterium benutzt, die Buddhalehre mehr oder weniger per definitionem von den in den alten Texten enthaltenen Hauptlehren abweicht. Es besteht kein Mangel in der wissenschaftlichen Literatur an Beispielen von Rekonstruktionen der ursprünglichen Buddhalehre, die so gut wie nichts mehr mit dem, was wir in den alten Texten finden,
Vgl. zum Beispiel O. von Hinüber, Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeit in Indien (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, Geistesund Sozialwissenschaftliche Klasse 1989; 11), Stuttgart 1989, 26 f.
192
gemein haben. So gesehen ist von der ursprünglichen Buddhalehre nur noch sehr wenig im buddhistischen Kanon erhalten geblieben. Nur Textstellen, die Ansichten und Lehren darstellen, die in Widerspruch mit allgemein anerkannten kanonischen Standpunkten stehen, würden Reste des sogenannten präkanonischen Buddhismus enthalten. Oder man läßt sogar. die gesamten alten Textsammlungen beiseite und versucht, die Buddhalehre mit Hilfe von anderen Quellen, wie zum Beispiel den Inschriften des Kaisers Aśoka, zu rekonstruieren.
Eine derartige Anwendung dieses an sich überzeugenden Kriteriums scheint mir zu weit zu gehen. Auch wenn die buddhistische Überlieferung die Lehre des Buddha nicht fehlerfrei erhalten hat, braucht dies noch nicht zu bedeuten, daß sie diese Lehre nur aus Versehen, und dann nur in einigen versteckten Nischen ihres Kanons, bewahrt hat.' Diese Art von Miẞtrauen gegenüber der buddhistischen Überlieferung ist genauso extrem wie das volle Vertrauen gegenüber derselben von seiten anderer. Die Wahrheit wird wahrscheinlich zwischen diesen beiden Extremen zu suchen sein. Wie aber unterscheidet man Buddhalehre von allem anderen?
Ein Vorschlag, der gemacht worden ist, richtet sich auf das dem Buddha zugeschriebene Wort. Das dem Buddha direkt zugeschriebene Wort sollte zuverlässiger sein als andere Teile des Kanons. Man könnte sich tatsächlich vorstellen, daß die Tradition sich scheute, dem Buddha neue
Auch Erich Frauwallner äußert sich so einer Haltung gegenüber kritisch: Nun hat Oldenberg in seinem klassischen Werk gezeigt, daß die Pali-Überlieferung hinsichtlich der Persön lichkeit des Buddha zahlreiche vollkommen glaubwürdige Züge enthält, und ich sehe nicht ein, warum das gleiche nicht auch für seine Lehre gelten soll, an deren Überlieferung seinen ältesten Anhängern sicher mehr gelegen war, als an der Überlieferung über seine Person. Natür lich müssen wir mit verschiedenen Umformungen rechnen, wie sie eine längere mündliche Überlieferung bedingt. I... Wer jedoch diese Lehrsätze dem Buddha abspricht oder meint, darüber hinaus eine ursprüngliche Lehre des Buddha rekonstruieren zu können, dem fällt die Pflicht zu, in glaubwürdiger Weise darzutun, wie die überlieferte Lehre des Kanons entstanden ist und wie sie dazu gekommen ist, das ursprüngliche Buddhawort zu verdrängen." In: E. Frauwallner, Geschichte der indischen Philosophie, Bd. 1 (Wort und Antwort; 6, 1), Salzburg 1953, 465 f.
+
Tilmann Vetter stellt in einigen Aufsätzen u. a. die Vinaya-Version der ersten Predigt, wie auch,Buddhawort' im allgemeinen, als besonders wichtig dar: vgl. T. Vetter, Bei Lebzeiten das Todlose erreichen. Zum Begriff amata im alten Buddhismus, in: G. Oberhammer (Hrsg.), Im Tod gewinnt der Mensch sein Selbst: Das Phänomen des Todes in asiatischer und abendländischer Religionstradition. Arbeitsdokumentation eines Symposions (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte; 624/Beiträge zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens; 14), Wien 1995, 211-230; ders., Das Erwachen des Buddha, in: Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 40 (1996) 45-85; ders., Tod im Buddhismus, in: C. von Barloewen (Hrsg.), Der Tod in den Weltkulturen und Weltreligionen, München 1996, 296-328.
193