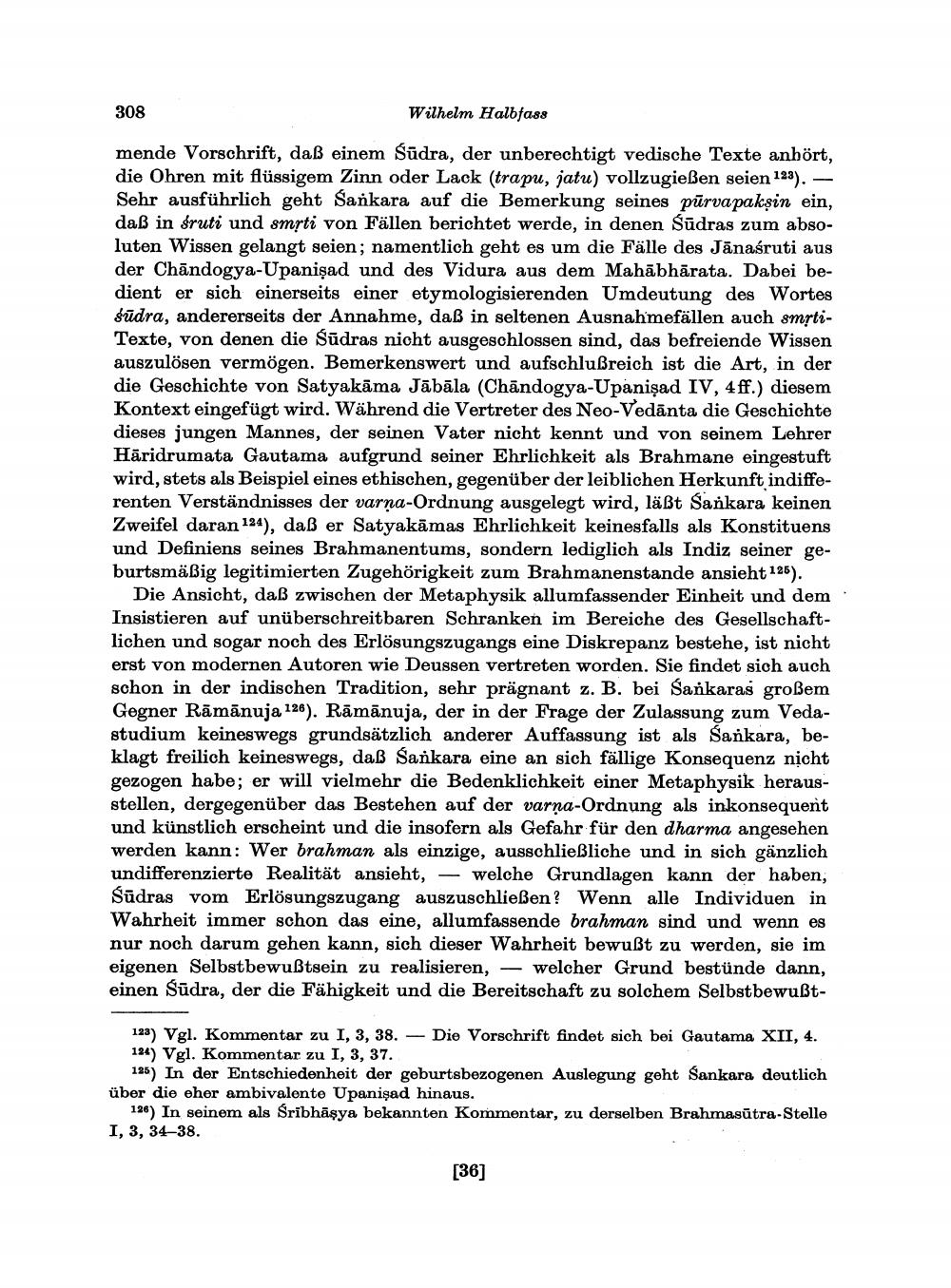________________
308
Wilhelm Halbfa88
mende Vorschrift, daß einem Sūdra, der unberechtigt vedische Texte anhört, die Ohren mit flüssigem Zinn oder Lack (trapu, jatu) vollzugießen seien 123). — Sehr ausführlich geht Sankara auf die Bemerkung seines pūrva pakşin ein, daß in sruti und smrti von Fällen berichtet werde, in denen Sūdras zum absoluten Wissen gelangt seien; namentlich geht es um die Fälle des Jānaśruti aus der Chāndogya-Upanişad und des Vidura aus dem Mahābhārata. Dabei bedient er sich einerseits einer etymologisierenden Umdeutung des Wortes sūdra, andererseits der Annahme, daß in seltenen Ausnahmefällen auch smrtiTexte, von denen die Sūdras nicht ausgeschlossen sind, das befreiende Wissen auszulösen vermögen. Bemerkenswert und aufschlußreich ist die Art, in der die Geschichte von Satyakāma Jābāla (Chāndogya-Upanişad IV, 4ff.) diesem Kontext eingefügt wird. Während die Vertreter des Neo-Vedānta die Geschichte dieses jungen Mannes, der seinen Vater nicht kennt und von seinem Lehrer Hāridrumata Gautama aufgrund seiner Ehrlichkeit als Brahmane eingestuft wird, stets als Beispiel eines ethischen, gegenüber der leiblichen Herkunft indifferenten Verständnisses der varna-Ordnung ausgelegt wird, läßt Sankara keinen Zweifel daran 124), daß er Satyakāmas Ehrlichkeit keinesfalls als Konstituens und Definiens seines Brahmanentums, sondern lediglich als Indiz seiner geburtsmäßig legitimierten Zugehörigkeit zum Brahmanenstande ansieht 125).
Die Ansicht, daß zwischen der Metaphysik allumfassender Einheit und dem Insistieren auf unüberschreitbaren Schranken im Bereiche des Gesellschaftlichen und sogar noch des Erlösungszugangs eine Diskrepanz bestehe, ist nicht erst von modernen Autoren wie Deussen vertreten worden. Sie findet sich auch schon in der indischen Tradition, sehr prägnant z. B. bei Sankaras großem Gegner Rāmānuja 126). Rāmānuja, der in der Frage der Zulassung zum Vedastudium keineswegs grundsätzlich anderer Auffassung ist als Sankara, beklagt freilich keineswegs, daß Sankara eine an sich fällige Konsequenz nịcht gezogen habe; er will vielmehr die Bedenklichkeit einer Metaphysik herausstellen, dergegenüber das Bestehen auf der varna-Ordnung als inkonsequent und künstlich erscheint und die insofern als Gefahr für den dharma angesehen werden kann: Wer brahman als einzige, ausschließliche und in sich gänzlich undifferenzierte Realität ansieht, — welche Grundlagen kann der haben, Sūdras vom Erlösungszugang auszuschließen? Wenn alle Individuen in Wahrheit immer schon das eine, allumfassende brahman sind und wenn es nur noch darum gehen kann, sich dieser Wahrheit bewußt zu werden, sie im eigenen Selbstbewußtsein zu realisieren, welcher Grund bestünde dann, einen Sūdra, der die Fähigkeit und die Bereitschaft zu solchem Selbstbewußt
123) Vgl. Kommentar zu I, 3, 38. – Die Vorschrift findet sich bei Gautama XII, 4. 124) Vgl. Kommentar zu I, 3, 37.
125) In der Entschiedenheit der geburtsbezogenen Auslegung geht Sankara deutlich über die eher ambivalente Upanişad hinaus.
126) In seinem als Sribhāşya bekannten Kommentar, zu derselben Brahmasūtra-Stelle I, 3, 34–38.
[36]