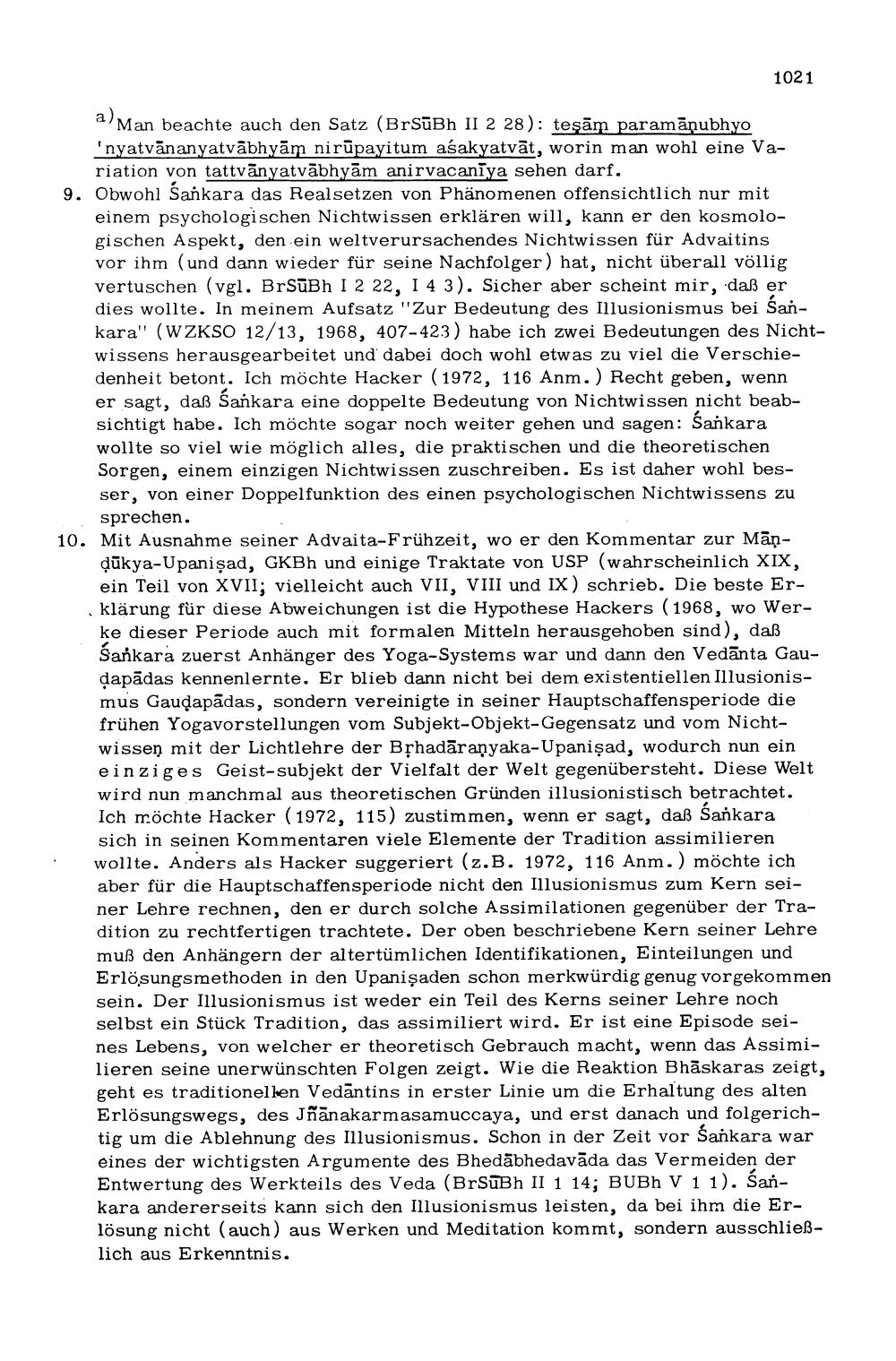________________
1021
a) Man beachte auch den Satz (BrSuBh II 2 28): teşām paramāņubhyo 'nyatvananyatvābhyām nirūpayitum aśakyatvāt, worin man wohl eine Variation von tattvanyatvābhyam anirvacaniya sehen darf.
9. Obwohl Sankara das Real setzen von Phänomenen offensichtlich nur mit einem psychologischen Nichtwissen erklären will, kann er den kosmologischen Aspekt, den ein weltverursachendes Nichtwissen für Advaitins. vor ihm (und dann wieder für seine Nachfolger) hat, nicht überall völlig vertuschen (vgl. BrSuBh I 2 22, I 4 3). Sicher aber scheint mir, daß er dies wollte. In meinem Aufsatz "Zur Bedeutung des Illusionismus bei Sankara" (WZKSO 12/13, 1968, 407-423) habe ich zwei Bedeutungen des Nichtwissens herausgearbeitet und dabei doch wohl etwas zu viel die Verschiedenheit betont. Ich möchte Hacker (1972, 116 Anm.) Recht geben, wenn er sagt, daß Sankara eine doppelte Bedeutung von Nichtwissen nicht beabsichtigt habe. Ich möchte sogar noch weiter gehen und sagen: Sankara wollte so viel wie möglich alles, die praktischen und die theoretischen Sorgen, einem einzigen Nichtwissen zuschreiben. Es ist daher wohl besser, von einer Doppelfunktion des einen psychologischen Nichtwissens zu sprechen.
10. Mit Ausnahme seiner Advaita-Frühzeit, wo er den Kommentar zur Māņdukya-Upanisad, GKBh und einige Traktate von USP (wahrscheinlich XIX, ein Teil von XVII; vielleicht auch VII, VIII und IX) schrieb. Die beste Erklärung für diese Abweichungen ist die Hypothese Hackers (1968, wo Werke dieser Periode auch mit formalen Mitteln herausgehoben sind), daß Sankara zuerst Anhänger des Yoga-Systems war und dann den Vedanta Gauḍapādas kennenlernte. Er blieb dann nicht bei dem existentiellen Illusionismus Gauḍapādas, sondern vereinigte in seiner Hauptschaffensperiode die frühen Yogavorstellungen vom Subjekt-Objekt-Gegensatz und vom Nichtwissen mit der Lichtlehre der Bṛhadaranyaka-Upaniṣad, wodurch nun ein einziges Geist-subjekt der Vielfalt der Welt gegenübersteht. Diese Welt wird nun manchmal aus theoretischen Gründen illusionistisch betrachtet. Ich möchte Hacker (1972, 115) zustimmen, wenn er sagt, daß Śankara sich in seinen Kommentaren viele Elemente der Tradition assimilieren wollte. Anders als Hacker suggeriert (z. B. 1972, 116 Anm.) möchte ich aber für die Hauptschaffensperiode nicht den Illusionismus zum Kern seiner Lehre rechnen, den er durch solche Assimilationen gegenüber der Tradition zu rechtfertigen trachtete. Der oben beschriebene Kern seiner Lehre muß den Anhängern der altertümlichen Identifikationen, Einteilungen und Erlösungsmethoden in den Upanisaden schon merkwürdig genug vorgekommen sein. Der Illusionismus ist weder ein Teil des Kerns seiner Lehre noch selbst ein Stück Tradition, das assimiliert wird. Er ist eine Episode seines Lebens, von welcher er theoretisch Gebrauch macht, wenn das Assimilieren seine unerwünschten Folgen zeigt. Wie die Reaktion Bhaskaras zeigt, geht es traditionellen Vedantins in erster Linie um die Erhaltung des alten Erlösungswegs, des Jñanakarmasamuccaya, und erst danach und folgerichtig um die Ablehnung des Illusionismus. Schon in der Zeit vor Sankara war eines der wichtigsten Argumente des Bhedabhedavāda das Vermeiden der Entwertung des Werkteils des Veda (BrSuBh II 1 14; BUBh V 1 1). Sankara andererseits kann sich den Illusionismus leisten, da bei ihm die Erlösung nicht (auch) aus Werken und Meditation kommt, sondern ausschließlich aus Erkenntnis.